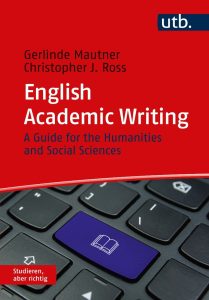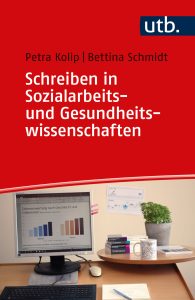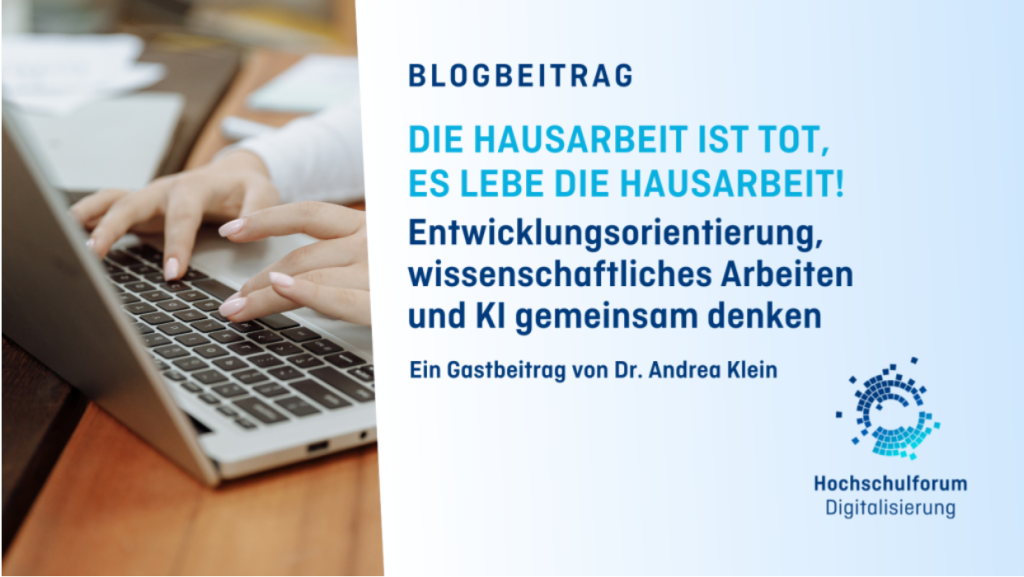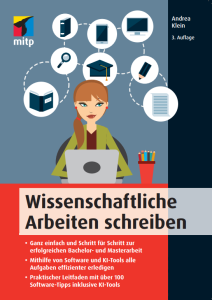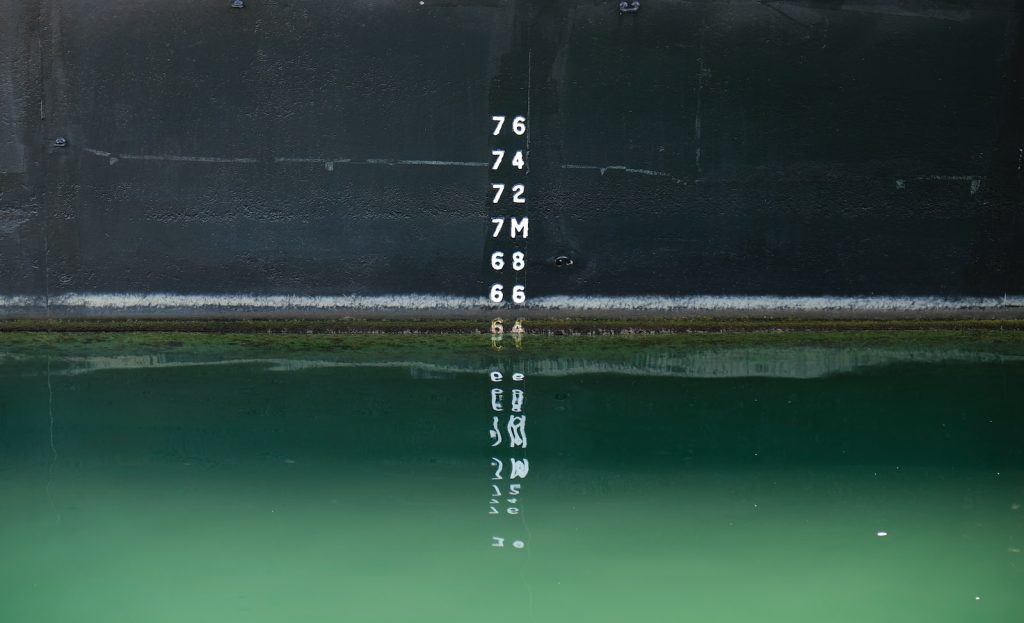Ein Gastbeitrag von Dr. Nicolaus Wilder
Als Lehrender in der Allgemeinen Pädagogik erlebe ich die spannendsten Momente, wenn ich Platons Höhlengleichnis mit den Studierenden diskutiere und darüber die eigene Bildungsbiografie reflektiere. Aber dazu später mehr.
Entstanden etwa um 375 v. Chr. im antiken Griechenland ist Platons Höhlengleichnis „bis heute die tiefste und eindringlichste Analyse des Bildungsgeschehens geblieben, die sich auffinden läßt“ (Ballauff 1969, S. 91). Auch wenn Platon erkenntnistheoretisch heute nur noch von ideengeschichtlicher Bedeutung ist, so trifft dies keineswegs auf seine bildungstheoretischen Überlegungen zu. Gerade in dem gegenwärtig ausgerufenen Zeitalter der Künstlichen Intelligenz scheinen diese aktueller und relevanter denn je zu sein.
Doch was hat das mit der Vermittlung von wissenschaftlichem Arbeiten zu tun? Bei Platon im Grunde alles: Während Bildung (paideia) bei Platon ein umfassender Prozess der Entwicklung und Formung der Seele von innen und außen ist, der auf die Erkenntnis des Wahren, Guten und Schönen abzielt, ist Wissenschaft (epistēmē) die methodische Erkenntnis dieser höheren Wahrheiten selbst. Bildung also beschreibt den Weg zur Wissenschaft. Sie ist die Formung genau derjenigen Seele, die eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler zur wahren Erkenntnis benötigt. Wissenschaftliches Arbeiten zu lehren bedeutet damit nichts anderes als die Ermöglichung von Bildungsprozessen hin zu einer wissenschaftlichen Haltung. Und was dieser Weg konkret bedeutet, beschreibt das Höhlengleichnis eindrücklich. Drei – hier nur analytisch getrennte, aber eigentlich stark miteinander verwobene – Aspekte scheinen mir dabei von besonderer zeitloser Aktualität zu sein:
1) das Streben nach Wahrheit und Gerechtigkeit
2) die selbstreflexive Erkenntnis des eigenen Schattendaseins und
3) die Aufgabe, das private und, vielleicht noch wichtiger, das öffentliche Leben zu verbessern
Diese gilt es im Folgenden holzschnittartig zu skizzieren.
Das Streben nach Wahrheit und Gerechtigkeit
Wissenschaft ist bei Platon nicht ohne eine teleologische Ausrichtung auf Wahrheit und Gerechtigkeit zu denken, wobei Gerechtigkeit im Grunde nur eine spezielle, aber für Platon die höchste, Wahrheit darstellt. Eine Wissenschaft, die nicht nach Wahrheit strebt, verkommt zu bloßer Rhetorik – Platons Kritik an den Sophisten seiner Zeit. Dieser Aspekt ist sicher am engsten verknüpft mit Platons Ideenlehre, also der Vorstellung, dass es ein Reich höherer, unveränderlicher und ewig wahrer Ideen gibt, von denen alles sinnlich Wahrnehmbare nur unvollkommene Manifestationen sind. Diese absoluten Ideen, die Platon grundsätzlich – jedoch tief unter falschen Vorstellungen verborgen – im Menschen angelegt sieht, über einen mühsamen Reflexionsprozess freizulegen, ist für ihn wesentliche Aufgabe der Wissenschaft, da sich daran alles weitere Handeln orientiert, auch das praktische. Diesen unmittelbaren Zusammenhang illustriert Platon wie folgt.
„Schließlich aber kam ich zu der Überzeugung, daß alle jetzigen Staaten samt und sonders politisch verwahrlost sind, denn das ganze Gebiet der Gesetzgebung liegt in einem Zustand darnieder, der ohne eine ans Wunderbare grenzende Veranstaltung im Bunde mit einem glücklichen Zufall nahezu heillos ist. Und so sah ich mich denn zurückgedrängt auf die Pflege der echten Philosophie, der ich nachrühmen konnte, daß sie die Quelle der Erkenntnis ist für alles, was im öffentlichen Leben sowie für den Einzelnen als wahrhaft gerecht zu gelten hat. Es wird also die Menschheit, so erklärte ich, nicht eher von ihren Leiden erlöst werden, bis entweder die berufsmäßigen Vertreter der echten und wahren Philosophie zur Herrschaft im Staate gelangen oder bis die Inhaber der Regierungsgewalt in den Staaten infolge einer göttlichen Fügung sich zu ernstlichen Beschäftigung mit der echten Philosophie entschließen.“
(Platon, VII. Brief, 326ab)
Platon, eigentlich angetreten, um politisch aktiv zu werden, „erfüllt von dem Drang nach staatsmännischer Betätigung“ (ebd.), stellt bei seiner kritischen Auseinandersetzung basierend auf seiner praktischen Erfahrung also fest, dass alle Staaten im Grunde ungerecht sind. Es fehlen gänzlich die Rahmenbedingungen, um auch nur die Möglichkeit zu haben, durch politisches Handeln den Staat verbessern zu können. Zur notwendigen Bedingung, um überhaupt eine Form von Handlungsmächtigkeit herzustellen, wird die Klärung der Frage, was Gerechtigkeit eigentlich ist. Nur auf Grundlage der Auseinandersetzung mit dieser Frage lässt sich die Gesellschaft entsprechend verbessern.
Das Zitat verdeutlicht mehrere Aspekte:
1) Am Anfang steht die radikale Reflexion des Ist-Zustandes.
2) Um den Ist-Zustand zu verändern, bedarf es der Formulierung einer wahren – oder etwas weniger platonisch ausgedrückt: begründeten – Alternative und
3) Wissenschaft hat eine hochgradige gesellschaftliche Orientierungsfunktion und ist damit genuin normativ zu denken. Eine wertfreie Wissenschaft wäre für Platon wahrscheinlich wertlos.
Auch wenn wir Platons Absolutheitsanspruch an Wahrheit heute überwiegend nicht mehr so teilen würden, sondern Wahrheit eher korrespondenz- (eine Aussage ist dann wahr, wenn sie mit der Wirklichkeit übereinstimmt), kohärenz- (eine Aussage ist dann wahr, wenn sie in einem System von Aussagen keine Widersprüche erzeugt) oder konsenstheoretisch (eine Aussage ist dann wahr, wenn sich darauf geeinigt wurde) denken, so bleibt das Streben nach einer Form von Wahrheit weiterhin konstitutiv für die Wissenschaft. Sonst ließe sich nicht plausibel von so etwas wie Fake News sprechen. Die Verantwortung einer normativen gesellschaftlichen Orientierungsfunktion lehnen große Teile der Wissenschaft jedoch gegenwärtig ab, was aber gerade in Zeiten großer gesellschaftlicher Transformationsprozesse nicht unproblematisch ist.

Die selbstreflexive Erkenntnis des eigenen Schattendaseins
Die fundamentale Bedingung für Wissenschaft ist bei Platon die Erkenntnis der eigenen Schatten und Echos. Wir sind alle gefesselt an das, was uns vorgelebt wird, die Werte, die wir teilen, die Sprache, die wir sprechen, die Entitäten, an die wir glauben. Heute würde man das mit dem Begriff der Sozialisation beschreiben, dem Aufwachsen in einer Gesellschaft mit einer spezifischen Perspektive auf Welt und Selbst. Und wir glauben nur zu gerne, dass diese Dinge, also unsere Überzeugungen, auch wahr sind.
In meinen Seminaren ist das immer einer der spannendsten Momente, wenn ich frage: Wofür stehen denn in dem Gleichnis die Menschen in der Höhle? Wenn man den Diskussionen genug Zeit gibt, kommt es häufig zu folgendem Verlauf: „Na ja, die Menschen damals halt, die wussten ja noch nicht so viel.“ Oder: „Kinder, Platon beschreibt da den Prozess des Erwachsenwerdens.“ Irgendwann kommt es dann aber auch dazu, dass die Teilnehmenden sagen: „Aber es gibt doch heute auch erwachsene Menschen, die nur in Ihrer Bubble leben (aber das sind natürlich nicht wir hier an der Uni).“ Und in seltenen Fällen endet es in der fundamentalen Einsicht: „Diese Menschen stehen für uns alle. Wir alle sind gefesselt an bestimmte Sichtweisen.“ Was Platon von uns auf dem Weg in die Wissenschaft verlangt, ist nicht weniger, als an all diesen Dingen zu zweifeln, an die wir glauben und von denen wir überzeugt sind – eben unserer Bubble, in der wir uns so wohlfühlen. Wir sollen uns auf die Suche nach der Wahrheit hinter den Schatten und Echos machen. Kein Wunder also, dass er diesen Prozess als zwang- und schmerzhaft beschreibt. Diesen Weg geht man weder freiwillig noch allein. Er muss begleitet werden und genau das ist bei Platon die Aufgabe der Pädagogen.
Der Weg zur Wissenschaft ist harte Arbeit am Selbst, dem eigenen Denken, Fühlen, Handeln und Urteilen, immer in Bezug auf das eigene Mensch-Welt-Verhältnis.
Diese fundamentale Dimension kritischer Selbstreflexion ist heute – auch in der Wissenschaft – verkümmert zu der Phrase des „kritischen Denkens“. In der Regel meint das ein kritisches Denken über die anderen, weil die eigene Position für die richtige, die wahre, die absolute gehalten wird. Platon aber meint das Gegenteil. Kritisches Denken meint zuvorderst ein kritisches Reflektieren des Selbst. Warum denke, fühle, glaube, meine ich, was ich denke, fühle, glaube oder meine? Und ich mache mich auf die Suche danach, ob es nicht auch anders sein könnte. Es geht Platon um die Überwindung der eigenen Ich-Bezogenheit.
In der neueren Wissenschaftstheorie ist genau das der zentrale Gedanke, der Popper bei der Idee der Falsifikation antrieb: Die Erkenntnis, dass der Mensch sich in seiner Meinung immer irren kann und wir uns genau deswegen auf die Suche nach dem machen müssen, was wir nicht glauben. Auch dieser Gedanke ist verkümmert zu dem Verfahren einer standardisierten Nullhypothesenformulierung. Aber es ist etwas ganz anderes, formal zu sagen, es gibt einen Schwan, der nicht schwarz ist und die Daten darauf zu testen, um zu aller Überraschung festzustellen, dass alle Schwäne weiß sind, oder sich auf den beschwerlichen Weg zu machen, den einen nicht schwarzen Schwan zu finden, von dem man überzeugt ist, dass es ihn nicht gibt.
Die Aufgabe, das private und das öffentliche Leben zu verbessern
Für Platon endet Wissenschaft aber nicht mit der Erkenntnis, mit dem Ausruhen auf der Insel der Seligen. Der härteste Teil beginnt erst dann. Aus der Einsicht in Wahrheit und Gerechtigkeit folgt die Notwendigkeit, auch andere daran teilhaben zu lassen und sich für eine Verbesserung des Lebens aller einzusetzen. Im Gleichnis wird das dargestellt durch den Rückgang in die Höhle und das Herausführen der in der Höhle Verbliebenen. Dieser Prozess ist durch größte Widerstände geprägt unter Bedrohung des eigenen Lebens, was von Platon an dieser Stelle keineswegs metaphorisch gemeint ist, sondern auf Sokrates Schicksal Bezug nimmt. Das ist die Pflicht der Wissenschaft. Sie darf sich nicht auf der Erkenntnis ausruhen, nur um am Ende zu sagen, „Ich hab es ja gewusst!“, sondern sie ist verpflichtet, Gesellschaft mitzugestalten. Wissenschaft ist von der Gesellschaft für die Gesellschaft und hat somit eine große gesellschaftliche Verantwortung. Bildung und Wissenschaft sind bei Platon also nicht als akademisches Spiel mit abstrakten Wissensbeständen gedacht, als Erkenntnis um der Erkenntnis willen, sondern hochgradig praktisch und politisch. Sie dienen der Verbesserung des Lebens.
Gerade jetzt, wo uns die potenziellen Gefahren Künstlicher Intelligenz langsam zu dämmern beginnen, in den ungeahnten Möglichkeiten, beliebige authentisch anmutende Deep Fakes zu erzeugen, Demokratien zu manipulieren, die Logik von Schatten und Echos nicht nur zu reproduzieren, sondern sogar zu verstärken, es im Grunde keine Instanz mehr gibt, die uns die Unterscheidung zwischen Wissen und Meinung abnimmt, scheint diese von Platon vorgeschlagene kritisch-reflexive Haltung des Ichs wichtiger denn je, genau wie die gesellschaftliche Verantwortung und die Fähigkeit in begründeten Alternativen oder gesellschaftlichen Utopien zu denken. Wie könnte eine Gesellschaft aussehen, in der KI im Dienst von Mensch und Gerechtigkeit steht? Antworten auf solche Fragen zu formulieren, ist genuine Aufgabe der Wissenschaft.
Die Lehre wissenschaftlichen Arbeitens kann in der Auseinandersetzung mit Platon und insbesondere seinem Höhlengleichnis einen wichtigen Beitrag leisten. Sie befähigt zum Eröffnen eben dieser Haltung, wenn sie nicht reduziert wird auf das Auswendiglernen bestimmter methodisch-dogmatischer Verfahren.
Literatur
Ballauff, T. (1969). Pädagogik. Eine Geschichte der Bildung und Erziehung. Band 1: Von der Antike bis zum Humanismus. Alber.

Dr. Nicolaus Wilder ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Allgemeine Pädagogik an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Gründungsmitglied des VK:KIWA (Virtuelles Kompetenzzentrum für Künstliche Intelligenz und wissenschaftliches Arbeiten) sowie Vorstandsmitglied des Zentrums für Konstruktive Erziehungswissenschaft e. V.