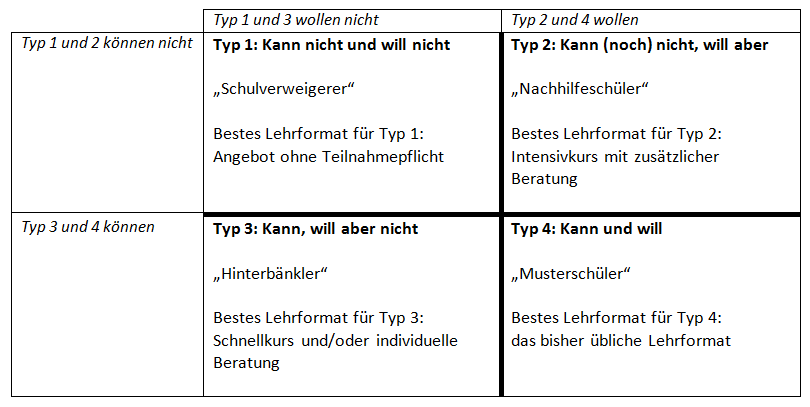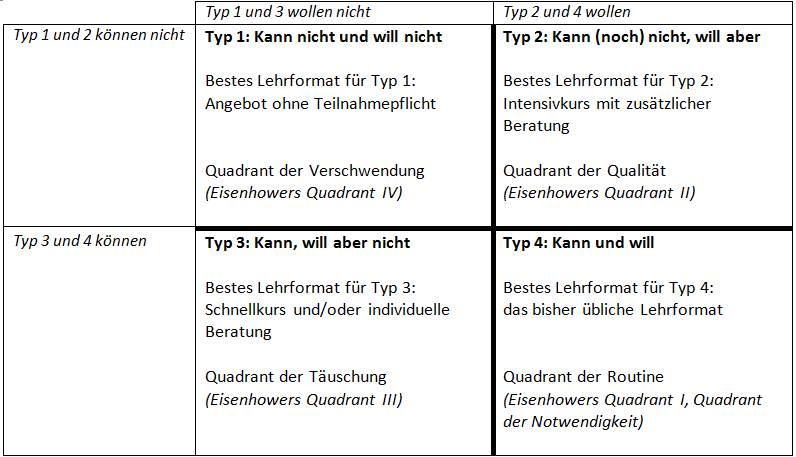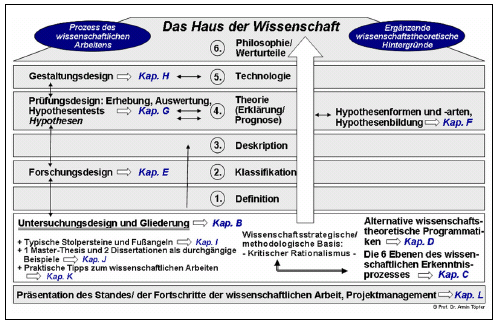Ein Gastbeitrag von Dr.-Ing. Wolfgang Hahnl
Wissenschaftliches Arbeiten beginnt bekanntlich mit einer Aufgabenstellung und der damit verbundenen Auswertung dokumentierten Wissens. Das Ziel besteht darin, durch neue Ideen zum Erkenntnisgewinn beizutragen. Das gilt für jede Wissenschaftsdisziplin, und damit auch für die technischen Wissenschaften. Die schöpferischen Leistungen der technischen Fachdisziplinen münden früher oder später in neue Produkte, Maschinen, Verfahren und Einrichtungen.
Doch in der Technik liegt dokumentiertes Wissen nicht nur in Büchern oder Fachartikeln vor, sondern vor allem auch in der Patentliteratur. Dieser Literaturzweig ist aufgrund seiner juristischen Beschreibungsweise selbst für Techniker schwer verständlich und wird daher leider zu selten in die wissenschaftliche Auswertung einbezogen.
-
Bedeutung von Patentdokumenten für die wissenschaftliche Arbeit
Derjenige, der eine Erfindung beim Deutschen Patent- und Markenamt einreicht, muss sie nach § 34 PatG so deutlich und vollständig darstellen, dass sie ein Fachmann ausführen kann. Wird die Erfindung nicht vollständig offenbart, weist das Patentamt die Anmeldung zurück. Auch der naheliegende Stand der Technik ist nach bestem Wissen vollständig zu beschreiben.
Diese gesetzlichen Anforderungen machen ein Patentdokument so wertvoll für die Gewinnung von Fachinformationen und definiert es als „Lehre zum technischen Handeln“ (BGH GRUR 65, 533, 534).
Die Lösung technischer Aufgabenstellungen wird in Patentdokumenten immer im Zusammenhang von Mittel/Merkmal/Ursache und Wirkung anhand mindestens eines Ausführungsbeispiels klar dargestellt.
Im Stand der Technik werden naheliegende technische Lösungen zitiert.
In manchen Datenbanken werden sogar Verknüpfungen zu den Dokumenten hergestellt, die das gerade betrachtete Dokument zitieren.
Beides kann ein Entwickler aufgreifen, um ergänzende Hintergrundinformationen zu gewinnen.
Erfindungen werden 18 Monate nach ihrer Einreichung vom Patentamt offen gelegt. Von diesem Zeitpunkt an kann jeder die Dokumente einsehen.
Die Veröffentlichung technischer Lösungen erfolgt durch Patentdokumente meist wesentlich eher als durch jeden anderen Fachartikel.
Eine Recherche in den Patentdatenbanken bietet unter anderem die Möglichkeit
- den Stand der Technik zu erfassen,
- Informationen über neue Entwicklungstrends zu erhalten oder
- seinen Wettbewerb zu beobachten.
Zusätzlich können Sie sich regelmäßig über Neuheiten Ihres Fachgebiets informieren lassen.
Patentämter bieten entsprechende Dienste kostenlos an.
-
Patente als Quellenangabe
Wollen Sie ein Patentdokument in Ihr Quellenverzeichnis aufnehmen, genügt die Angabe der Patentnummer, z. B. DE 10 2009 032 A1.
Am Anfang steht der Ländercode (DE für Deutschland), gefolgt vom länderspezifischen Aktenzeichen und dem Schriftartcode A1 (A1 für Offenlegungsschrift). Damit ist jedes Dokument eindeutig identifizierbar. Jeder kann eine so gekennzeichnete Quelle leicht in der Patentdatenbank des jeweiligen Landes finden.
-
Patentdatenbanken – komplizierter als die Suche im Web
Jedes Land besitzt ein eigenes Patentamt. Jedes Patentamt archiviert eine große Anzahl von Patentdokumenten. Die weltweiten Archive der Patentämter sind nicht deckungsgleich.
Allein das Deutschen Patent- und Markenamt verfügt über mehr als 80 Mio. Patentdokumente.
Das betrifft 80 Mio. Ideen, technische Lösungen und Handlungsanweisungen.
Eine Recherche in diesen Datenbanken ist komplizierter als die Suche im Web. Die Patentdatenbanken jedes Landes verwenden eigene Suchvariablen und Syntaxen. Mit etwas Grundwissen, den richtigen Werkzeugen und einer angemessenen Suchstrategie findet man die Nadel im Heuhaufen.
-
Über die Ablagestruktur von Patenten
Das gesamte Gebiet der Technik ist systematisch strukturiert. Die Struktur wird als Internationale Patentklassifikation (IPC) bezeichnet. Verantwortlich für die Herausgabe und ihre ständige Aktualisierung ist die Weltorganisation für geistiges Eigentum, auf Neudeutsch: World Intellectual Property Organisation (WIPO).
Die IPC enthält 70.000 Unterteilungen. Die darauf aufbauende Deutsche Patentklassifikation (DEKLA) umfasst 110.000 Gliederungspunkte.
Jede Erfindung, die bei einem Patentamt eingereicht wird, wird im Rahmen der Vorprüfung mindestens einer dieser Gliederungspunkte zugeordnet.
Bevor man also eine Recherche nach dem Stand der Technik in den Datenbeständen der Patentämter startet, empfiehlt es sich, mit einer IPC-Recherche zu beginnen. Das ist eine Suche nach dem zutreffenden IPC-Symbol. Warum?
Bei der Beschreibung eines Erfindungsgedankens gehen Erfinder und Patentanwälte sehr ideenreich vor. Sie kreieren mitunter neue Wortschöpfungen, verwenden englische Bezeichnungen oder bevorzugen Oberbegriffe. Hierfür gibt es sowohl fachliche als auch taktische und/oder juristische Gründe. Aus einem Hammer wird sehr schnell ein Impulsgeber, ein Werkzeug für den Schmied, für den Dachdecker zum Einschlagen und Ziehen von Nägeln usw. Das macht die Recherche nur nach Suchbegriffen nahezu unmöglich.
-
Warum sind Patentdokumente schwer verständlich
Patentdokumente werden meist von Patentanwälten unter juristischen Gesichtspunkten formuliert. Es geht um einen möglichst großen Schutzumfang und im Rechtsstreit meist um sehr viel Geld.
Doch wenn man sich erst einmal mit der Struktur von Patenten vertraut gemacht hat und weiß, dass neben üblichen Fachbegriffen auch Oberbegriffe oder neue Wortschöpfungen zur Anwendung kommen, gelingt durch regelmäßiges Üben wissenschaftliches Arbeiten auch mit dieser Literaturgattung immer besser.
-
Wie sollte man Patentdokumente lesen, um sie besser zu verstehen
Patente unterliegen einer klaren Gliederung. Die Patentansprüche sind das Wesen eines Patentes. Beschreibung und Abbildungen dienen zur näheren Erklärung der Patentansprüche. Sie stellen das Lexikon für ein Patent dar.
Es empfiehlt sich, mit den Patentansprüchen zu beginnen. Das hilft bei der Entscheidung: Muss ich den kompletten Text (Patentschriften können schon einmal locker 30 Seiten und mehr umfassen) durcharbeiten oder ist das Dokument eher nicht zielführend.
-
Bedeutung von Patenten für ein Unternehmen
Patente schützen Ideen. Der Schutzumfang ist zeitlich (so lange Patentgebühren bezahlt werden, maximal 20 Jahre) und räumlich (nur für das Land, für das ein Patent erteilt wurde) begrenzt.
Die eigentliche Zündkraft steckt in den §§9 und 10 PatG. Es ist allein dem Patentinhaber erlaubt, seine Erfindung zu nutzen. Er hat das Recht jedem Dritten zu verbieten, Produkte und/oder Verfahren, die durch das Patent geschützt sind, herzustellen.
Der Wert eines Patentes offenbart sich meist bei gerichtlichen Auseinandersetzungen.
Geht man von einem Patentstreit zwischen Apple und Samsung aus, bei dem Apple für 5 Patentverletzungen durch Samsung 87 Mio. Euro zugesprochen bekam, betrifft das 17,4 Mio. pro Patent. (Zeit online (2014) Samsung muss Apple Schadenersatz zahlen, Zugriff: 31.08.2014)
In Deutschland beziffern sich die Streitwerte nicht ganz so hoch.
Offenlegungsschriften gelten als ungeschützte Patentdokumente und haben den materiellen Wert von 0 €. Achtung: Sobald aber das Patent erteilt wird, ändert sich die Sachlage.
Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BiMoG) erlaubt es Unternehmen, Patente als immaterielle Werte in die Bilanz aufzunehmen.
-
Erfinder und/oder Eigentümer von Patenten
Jeder Erfinder, der bei einem Unternehmen fest angestellt ist, ist nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz verpflichtet, seinem Arbeitgeber die Erfindung unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Der Arbeitgeber entscheidet dann, ob er die Diensterfindung in Anspruch nehmen möchte oder nicht. Nimmt er die Erfindung in Anspruch, ist er Eigentümer der Erfindung. Nimmt er sie nicht in Anspruch, steht es jedem Erfinder frei, seine Erfindung selbst beim Patentamt einzureichen.
-
Erfindung und Urheberrecht
Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen, Sprachwerke, Schriftwerke, plastische Darstellungen, Reden und Computerprogramme sind geistige Schöpfungen und zählen gemäß § 2 UrhG zu den geschützten Werken.
Der Begriff der Erfindung ist laut Schulte, dem Standardwerk der Patentanwälte, ein unbestimmter Rechtsbegriff, dessen Ausfüllung der Rechtsprechung und der Lehre überlassen werden.
Das einzige brauchbare Abgrenzungskriterium für die Erfindung gegenüber anderen geistigen Leistungen ist der Bezug zur Technik. Damit unterliegt es dem Patentgesetz und nicht mehr dem Urheberrechtsgesetz (UrhG).
-
Neue Lösungsansätze durch die kombinierte Versuchs-und-Irrtum-Methode
In der Literatur werden viele Methoden zur Lösung technischer Problemstellungen propagiert.
Ich halte die systematische Herangehensweise als eine Grundvoraussetzung, um auf wissenschaftlichem Weg neue Lösungsansätze, neue Lösungsideen zu erarbeiten.
Meine Methode bezeichne ich als „kombinierte Versuchs-und-Irrtum-Methode“ (kurz: koVIM).
Sie hat mir geholfen, bei verzwickten, widersprüchlichen technischen Problemstellungen Lösungen zu finden und zum Patent anzumelden.
Können Sie sich vorstellen, einmal mit Ihren Studierenden einen Ausflug in diese andere Art der Recherche zu wagen?
Über den Autor
Erfindungen und Patente faszinieren Dr.-Ing. Wolfgang Hahnl seit Beginn seiner beruflichen Laufbahn. Er verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung als Entwicklungsingenieur und hat 83 Erfindungen in Deutschland und den USA zum Patent angemeldet.
Seine Erfahrung hat Dr. Hahnl sowohl als nebenberuflicher Dozent und Betreuer von Diplomarbeiten weitergegeben als auch für die Projektleitung mehrerer von BMBF geförderter Verbundprojekte genutzt. Auch noch im Ruhestand betreut er seit 2013 ein vom BMWi gefördertes Projekt zur Nutzung von Strahlungswärme in der Stahlindustrie zur direkten Umwandlung in Elektroenergie mittels thermoelektrischer Generatoren.
In Dr. Hahnls Buch „Praktische Methoden des Erfindens – Kreativität und Patentschutz“ (Springer 2015) können Sie neben allen Informationen aus dem Artikel 35 Internetadressen öffentlich zugänglicher elektronischer Patentarchive, mit Beispielen für Syntax und Suchanfragen uvm. ausführlich nachlesen.
Weitere Informationen zum Autor finden Sie auch im XING-Netzwerk.