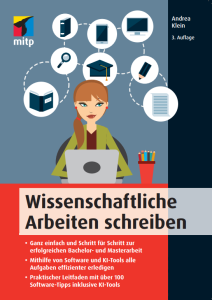Ja, richtig gelesen, ehrenwörtliche Danksagung.
Gibt es nicht.
In diesem Beitrag möchte ich zwei Themen verknüpfen, die sonst getrennt voneinander behandelt werden. Wenn sie überhaupt behandelt werden. Denn es geht um zwei Themen, die in Ratgebern eher wenig Beachtung finden, um
- die ehrenwörtliche Erklärung und
- die Danksagung.
Die ehrenwörtliche Erklärung
Die ehrenwörtliche Erklärung, oft auch eidesstattliche Erklärung oder Selbständigkeitserklärung, wird wohl überall für die meisten Prüfungsleistungen verlangt. Sie fehlt in keinem der von Hochschulen, Fachbereiche oder Institute herausgegebenen Leitfäden zum wissenschaftlichen Arbeiten. Die Formulierungen variieren etwas. Im Grunde besagt die Erklärung jedoch, dass die vorliegende wissenschaftliche Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst wurde, dass nur die angegebenen Hilfsmittel genutzt und alle Zitate kenntlich gemacht wurden. Zudem unterschreiben die Studierenden, dass ihre Arbeit noch nicht in gleicher oder ähnlicher Form oder auszugsweise im Rahmen einer anderen Prüfung vorgelegt worden ist.
Was ist also erlaubt beim wissenschaftlichen Schreiben und was nicht?
Unstrittig dürfte sein, dass Ghostwriting nicht zulässig ist: Es wurden dann, technisch gesprochen, nicht alle Hilfsmittel angegeben, und von einem selbständigen Verfassen der Arbeit sind wir hier meilenweit entfernt. Ebenso unzulässig ist natürlich Plagiarismus: Hier fehlt die Kennzeichnung aller Zitate. Ein zweites Einreichen von ein und derselben Arbeit wird auch ausdrücklich untersagt, damit der Punktevergabe jeweils auch eine echte Leistung gegenübersteht.
So weit, so gut.
„Ohne fremde Hilfe“
Bliebe noch der Aspekt der fremden Hilfe. Was soll das bedeuten – die Arbeit wurde „ohne fremde Hilfe“ verfasst? Regen wir als Lehrende die Studierenden nicht sogar an, sich Hilfe in Form von Feedback und Korrekturlesen zu suchen? Schlagen wir ihnen nicht vor, andere Personen zu Rate zu ziehen, um einen zweiten Blick auf die Arbeit zu bekommen? Und, zu guter Letzt, geben wir nicht sogar selbst eine Art von Hilfe, wenn wir die Studierenden bei ihren Arbeiten beraten und betreuen? Wir reden mitunter stundenlang über alle möglichen Aspekte mit ihnen – über fachliche und methodische Fragen, über die Struktur ihres Texts, über den Prozess des Schreibens, und und und.
Oder soll die Phrase „ohne fremde Hilfe verfasst“ in den Erklärungen einfach nur bedeuten, dass die Arbeit „ohne fremde Hilfe geschrieben“ wurde? Dies würde auf eine enge Auslegung des Wortes „schreiben“ deuten, die wirklich nur das Niederschreiben meint und nicht die vorgelagerten Schritte der Themeneingrenzung, Gliederung etc. Aber das ergibt wenig Sinn, denn Überarbeiten gehört zum Schreiben dazu, und Überarbeiten kennt die Modi „allein“ und „gemeinsam“ – womit wir wieder am oben genannten Punkt stehen: Wir selbst sagen den Studierenden doch, dass es sehr gern gesehen ist, wenn sie sich dabei Unterstützung holen. Stichwort „Textblindheit“ und „Vier Augen sehen mehr als zwei“ usw.
Mit ein bisschen fremder Hilfe: die Grenzfälle
Neben den eindeutigen Fällen wie Ghostwriting, Plagiarismus und Doppelteinreichung haben wir es demnach auch noch mit Grenzfällen zu tun: Ab welchem Umfang oder welcher Art von Hilfe wird die Anforderung des selbständigen Verfassens nicht mehr erfüllt?
- Darf ich meine Mitstudierenden und Freunde Korrektur lesen lassen? – Ja.
- Darf ich ein professionelles Korrektorat bezahlen? – Hm. Für manche ist da bereits eine Linie überschritten.
- Darf ich ein professionelles Lektorat bezahlen? – Doppelt hm.
- Darf ich mit meinem Betreuer alle Fragen rund um die Arbeit diskutieren? – Ja.
- Darf ich mir in der Beratungsstelle der Hochschule Hilfe holen, wenn die Belastung zu groß wird und ich mit der Arbeit nicht mehr vorankomme? – Ja.
- Darf ich das Schreibzentrum in Anspruch nehmen? – Ja.
- Darf ich für all das, was Betreuer, Beratungsstelle und Schreibzentrum tun einen Coach bezahlen? – Hm, das würden viele kritisch sehen. (Ich meine: Ja, das darf ich.)
Viele (die meisten? alle?) studentischen Arbeiten entstehen also in Gemeinschaft. Dabei ist, wie wir eben gesehen haben, nicht klar abgrenzbar, welche Art von Hilfe überhaupt zulässig ist. Überdies ist nicht zu bemessen, wessen Beitrag tatsächlich wie viel Hilfe bedeutet und ab wann die Selbständigkeit beim Verfassen nun gefährdet ist. Hat vielleicht eine kleine Frage des Peer Tutors eine große Erkenntnis ausgelöst? Hat eine Anmerkung des fachfremden Onkels dazu geführt, dass bestimmte Aspekte deutlicher herausgearbeitet wurden? Weist mich ein Feedbackgeber auf einen relevanten Fachartikel hin, den ich bei meiner Recherche übersehen habe?
Unterlassene Hilfe
Wie helfen die Hochschulen bei diesem gedanklichen Zwiespalt weiter?
Gar nicht.
Sie tun einfach so, als gäbe es all das nicht und verlangen eine ehrenwörtliche oder eidesstattliche Erklärung mit den oben genannten Formulierungen zu Selbständigkeit und Hilfe. Wissenschaftliche Veröffentlichungen, also Arbeiten abseits einer Prüfungsleistung, nutzen meist das Vorwort oder eine separate Danksagung , um all jene zu nennen, die das Zustandekommen ermöglicht haben.
Aber die Studierenden unterschreiben am Ende trotz all dieser Hilfe oder Anregung, die mir völlig normal erscheint, dass sie ihre Arbeit „ohne fremde Hilfe“ verfasst haben. – Triple hm.
Sind Danksagungen in studentischen Arbeiten angebracht?
Jetzt kommt das zweite Thema ins Spiel, die Danksagung. Vielerorts unüblich, vielleicht auch einfach nur peinlich? Albern? Übertrieben? Heuchlerisch und schleimig?
Ich habe mich einmal in Studierendenforen umgesehen, was in einschlägigen Threads zu dieser Frage geschrieben wird. Tenor: Eine Danksagung, ob separat oder in einem Vorwort, wird bei der Bachelorarbeit und oft auch noch bei der Masterarbeit für lächerlich gehalten, weil diese Arbeiten durch ihren vergleichsweise geringen Umfang und durch die relativ kurze Bearbeitungszeit gar nicht so anstrengend gewesen sein können, als dass man sich bei irgendwem bedanken müsste (!). Ein persönlich ausgesprochenes Danke wäre im Fall der Fälle eine gute Alternative. Ab der Doktorarbeit, die ja schließlich auch publiziert wird, könne man dann einmal darüber reden bzw. da wäre es ja nun geradezu Pflicht! Eine Ausnahme scheinen Bachelor-/Masterarbeiten zu bilden, bei denen externe Partner involviert waren, etwa bei Arbeiten in einem Unternehmen oder wenn man fremde Labore nutzen durfte. Ansonsten unterscheiden sich die Gepflogenheiten stark zwischen den Fächern oder auch zwischen den Institutionen.
Einer der Forenbeiträge stellt übrigens explizit die Verbindung zum selbständigen Verfassen der Arbeit her und „warnt“ vor allzu großer Offenheit:
„Ich würde es nicht machen, weil es einfach überzogen finde. Und mehr als deinen Familienangehörigen und/oder deinem Freund/deiner Freundin würde ich eh nicht danken, sonst könnte der Prof. noch auf andere Gedanken kommen (bezüglich der eidesstattlichen Erklärung).“ (https://www.studis-online.de/Fragen-Brett/read.php?3,940774)
Aber wäre nicht gerade eine Danksagung nötig, um die erhaltene Hilfe transparent zu machen? Wäre das nicht der beste Platz dafür?
Was raten Sie Ihren Studierenden in Hinblick auf die Danksagung? Vor allem: Wie begründen Sie es, wenn es keine Danksagung in den Abschlussarbeiten geben soll?
Weiterführende Links:
Ein Artikel von Dr. Natascha Miljkovic: http://www.plagiatpruefung.at/eidesstattlich-erklaerung/