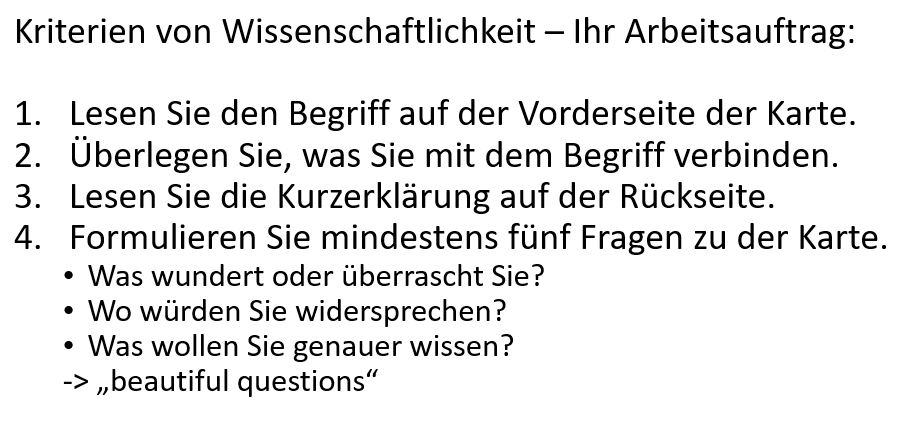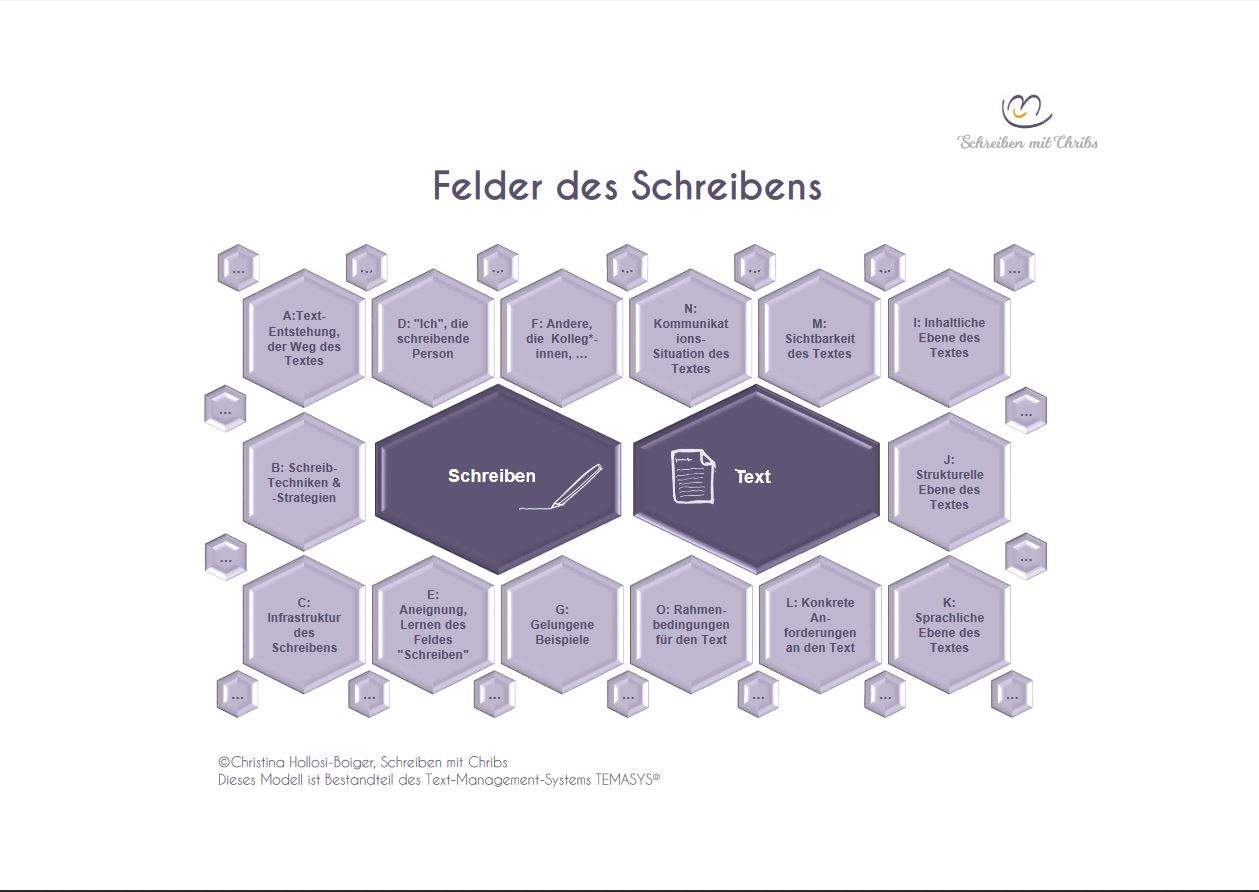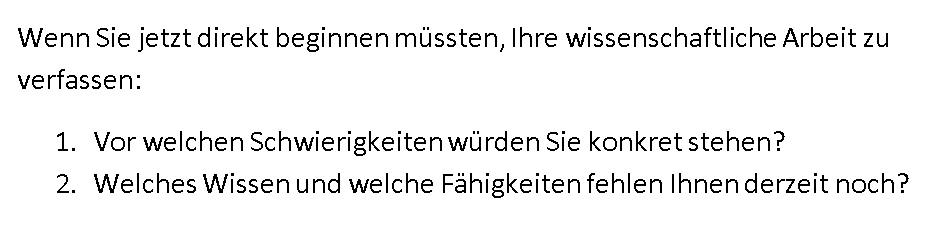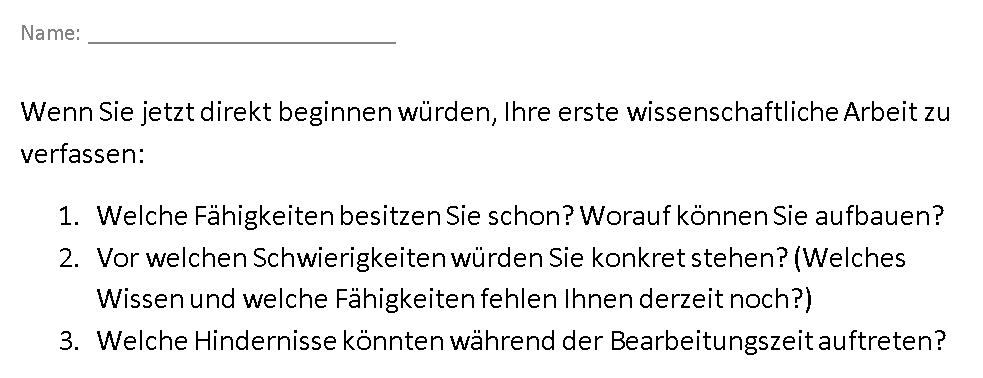Zum Semesterbeginn nutze ich als Einstieg in eine Lehrveranstaltung zum wissenschaftlichen Arbeiten gern Bilder. Ich frage die Studierenden, was Forschen eigentlich für sie bedeutet und mit welchem Bild oder Symbol sich das am besten ausdrücken lässt.
Wie geht’s?
Der Ablauf ist denkbar simpel und genauso einfach wie im Eingangssatz beschrieben.
Schritt 1: Passende Bilder zum Thema „Forschung“ finden
Ich starte mit einer kurzen Einführung und gebe den Studierenden dann ein paar Minuten Zeit, um sich Gedanken zu machen und Bilder, die sie mit dem Thema „Forschung“ verbinden, zu suchen oder aber auch selbst zu erstellen. Zehn Minuten reichen erfahrungsgemäß aus.
In Präsenzveranstaltungen bringe ich meist meinen Kartensatz mit. Dabei handelt es sich um einen Kartensatz, der sonst im Coaching eingesetzt wird und der verschiedenartige Bilder enthält. So etwas meine ich:

Solche Kartensätze findet man unter den Stichwörtern „Kartenset“, „Coachingkarten“ oder „Bildkarten“ oder kann sie bei Bedarf individuell aus eigenen Fotos herstellen, wenn man genügend symbolträchtige Szenen aufgenommen hat.
Handelt es sich um eine Online-Veranstaltung suchen die Studierenden im Internet oder ihrer privaten Fotosammlung und posten ihr Bild z.B. auf einem Padlet.
Mischformen sind ebenfalls denkbar. So könnten Sie in einer Präsenzveranstaltung beide Herangehensweisen kombinieren, indem Sie den Kartensatz auslegen, aber dennoch die Ergebnisse auf einem Padlet festhalten lassen. Dann müssten Studierende, die eine physische Karte wählen, diese fotografieren und online einbinden, was schnell zu erledigen ist.

Für dieses Beispiel habe ich einen Auszug gewählt, in dem nur Bilder zu sehen sind. Üblicherweise schreiben die Studierenden noch ein paar Wörter zum ausgewählten Bild und kommentieren die Beiträge der anderen.
Selbstverständlich können Sie es, egal welcher Variante genutzt wird, den Studierenden auch freistellen, selbsterstellte Skizzen einzubringen. Das geht sowohl online als auch offline.
Schritt 2: Gemeinsames Betrachten und Würdigen der Beiträge
Wenn alle „ihr“ Bild gefunden und bereitgestellt haben, lassen wir die Galerie einen Moment auf uns wirken und kommen anhand der Bilder ins Gespräch über Wissenschaft und Forschung.
Gesamteindruck:
- Welche Motive treten gehäuft auf?
- Welche stechen heraus?
- Möchte jemand noch eine verbale Erläuterung zum eigenen Beitrag ergänzen?
Einzelne Motive:
- Was sagt ein bestimmtes Motiv aus?
- Welche Vorstellungen von Wissenschaft und vom Forschungsprozess stecken dahinter, und wozu führt das?
- Was ist das Gute daran, was wirkt eher hinderlich?
Auch bei den vermeintlich selbsterklärenden Bildern wie dem eines steinigen Wegs, einer Treppe oder eines Schlüssels lohnen sich ein genauerer Blick und das Nachfragen. Vielleicht war ja etwas Anderes gemeint? Bei Bildern, deren Bedeutung nicht auf der Hand liegt, wird es dann spannend: Was hat ein sichtlich mitgenommener Fußballer mit Forschen zu tun? Drückt das Teamgeist aus? Oder Siegeswillen? Oder Zähigkeit? Oder war der Umgang mit Sieg und Niederlage gemeint? Von allem ein bisschen was?
Manchmal ergeben sich auch inhaltliche Bezüge, so dass man auf die folgenden Lehrveranstaltungen im Semesterverlauf verweisen kann. Etwa könnte sich herausstellen, dass jemand mit dem Bild speziell den Umgang mit Literatur oder das Zitieren gemeint hat und gar nicht das Forschen insgesamt. Dann ließe sich auf die entsprechenden Termine verweisen.
Wenn Sie mögen, können Sie auch noch Ihre persönliche Sicht auf Wissenschaft und Forschung in Form eines ausgewählten Bildes einbringen. Achten Sie in dem Fall ganz besonders darauf, dass dies nicht als Musterlösung missverstanden wird. Gerade sehr junge Studierende kommen oft mit dem Gedanken an die Hochschule, dass es immer „die eine richtige Lösung“ für eine Frage geben muss. Betonen Sie an der Stelle noch einmal, wie positiv es ist, dass eine Vielfalt an Bilder zusammengetragen wurde und dass Forschungsprozesse unterschiedlich verlaufen und wahrgenommen werden können.
Schritt 3: Dokumentation
Ich halte das Ergebnis in Form eines Fotos oder Screenshots fest und binde es in meine Upload-Materialien ein, die die Studierenden im Nachgang von mir erhalten.
Meine Erfahrungen mit dieser Übung
In drei Punkten möchte ich meine Erfahrungen zusammenfassen.
Bereitschaft der Studierenden
Bisher haben alle Gruppen, in der ich diese Übung durchführen wollte, mitgemacht – und soweit ich das einschätzen kann, auch gern. Das Suchen der Bilder macht Spaß; irgendwas Gutes, Treffendes und manchmal sogar Lustiges findet man immer. Auch das Betrachten der fremden Bilder macht Spaß, denn es gibt einen persönlichen Eindruck von den Mitstudierenden (wobei man natürlich sehr gut steuern kann, wie viel man preisgibt).
Der Wortlaut der Frage
Warum frage ich eigentlich nach „Forschen“ und nicht nach „wissenschaftlich arbeiten“?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei der Frage nach dem wissenschaftlichen Arbeiten die Antworten (gerade bei Studienanfänger:innen) tendenziell auf Zitieren und formale Aspekte hinauslaufen und die Erkenntnisgewinnung als solche keine Rolle spielt. Um dem entgegenzuwirken und den Blick zu weiten, frage ich nach dem Forschen. Interessanterweise tauchen überproportional Bilder von Laborkitteln auf, und zwar auch in Nicht-Labor-Studiengängen. Dass „echtes Forschen“ nicht bedeuten muss, Experimente in Laboren durchzuführen, kann man bei dieser Gelegenheit gut ansprechen.
Verwendete Bilder
Eine Anmerkung noch zur Frage „Kartensatz vs. freie Bildersuche“: Eine vorgefertigte Auswahl beschränkt die Studierenden natürlich und Aspekte des Forschens, die „außerhalb des Kartensatzes“ liegen, haben es schwer. Im anschließenden Gespräch lassen sich aber auch diese integrieren, z.B. durch die Nachfrage „Was hätten Sie gern gewählt, wenn es die entsprechende Karte gegeben hätte?“
Bei der Bildersuche im Internet begnügen sich manche mit den ersten Treffern, die sie mit dem Suchbegriff „Forschung“ erhalten. Das führt dann zu einer eher langweiligen und unpersönlichen Bildwand. Auch das lässt sich im Gespräch gut abfangen. Manchmal erzähle ich dann beispielsweise von früheren Gruppen und deren Bildauswahl und frage, was diese Studierenden wohl bewogen haben mag, gerade diese Bilder zu wählen.
Alternative Einsatzmöglichkeiten für die Übung
Die Methode lässt sich nicht nur zu Beginn des Semesters, sondern auch zu anderen Zeitpunkten einsetzen. Sie eignet sich hervorragend, um sich über die verschiedenen Vorstellungen von Wissenschaft und Forschung auszutauschen. Das kann nicht nur zu Beginn des Bachelor-Studiums, sondern auch später – eigentlich immer – sinnvoll sein, um Fehlannahmen aufzudecken und über unterschiedliche Vorstellungen besser ins Gespräch zu kommen. Gerade wenn, wie z.B. im Fall von Promovierenden, die Teilnehmenden auch schon selbst in der Lehre tätig sind, ist das hilfreich, um zielführendere Vorstellungen aufzubauen oder zumindest neben die negative Sicht zu stellen.
Beispiel: Ein Doktorand hat das Bild vom Boxkampf gewählt (Assoziationen: sich eine blutige Nase holen, sich durchschlagen, das Gegenüber bezwingen). Ist das sein einziges Bild vom wissenschaftlichen Arbeiten, wird er die Studierenden kaum zu Kooperation inspirieren. Dies wäre beispielsweise eine Voraussetzung für Peer-Feedback. Hier würde ich also zum einen fragen, ob und wenn ja welche positiven Aspekte das Boxen mit sich bringt. Vielleicht finden sich ja dabei auch Anknüpfungspunkte in Richtung „Kooperation“. Zum anderen würde ich versuchen herauszubekommen, welche positiven Erfahrungen der Doktorand selbst mit Kooperation in der Forschung gemacht hat und in welchem Bild er diese fassen kann.
Fazit
Auch mir als Dozentin gefällt diese Übung sehr gut. Sie ist abwechslungsreich und so etwas wie eine kleine Wundertüte. Denn ich weiß nie, welche Bilder gewählt werden und welche Assoziationen die Studierenden dazu haben. Die Übung fordert mich, weil ich im Gespräch alle zur Geltung kommen lassen und gleichzeitig ungünstigen Denkmustern sanft entgegenwirken möchte.
Ein weiteres Plus: Im Semesterverlauf kann ich zum passenden Zeitpunkt – also wenn wir uns mit den jeweiligen Aspekten des Forschungsprozesses beschäftigen – wieder an die Bilder erinnern und darauf Bezug nehmen. Die Übung ist im wahrsten Sinne des Wortes anschaulich und daher einprägsam für alle Beteiligten.