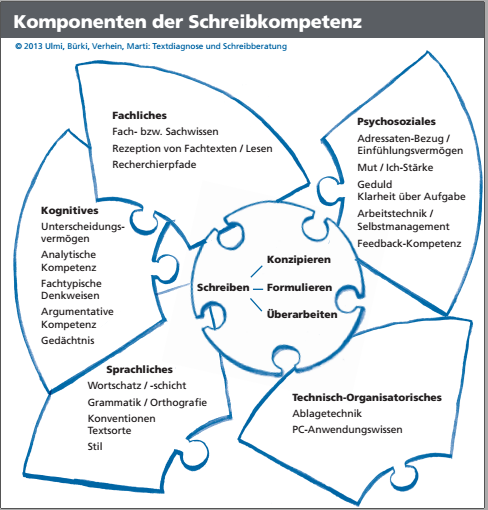Ein Gastbeitrag von Dr. Ulrike Hanke
Langsam füllen sich die Reihen. Es wird getuschelt, technische Geräte werden platziert und angeschlossen, Schreibutensilien bereitgelegt. Vorne steht Frau Dr. Barlin und beobachtet das Treiben. Sie ist schon sehr gespannt auf das Seminar, denn sie hat sich ein neues Konzept ausgedacht.
Dann beginnt sie mit dem Unterricht. Sie begrüßt die Studierenden, stellt sich kurz mit Namen vor und benennt das Thema des Seminars. Dann beginnt sie zu erzählen: Sie erzählt, wie sie vor ein paar Jahren vor der Aufgabe stand, ihre BA-Arbeit schreiben zu müssen, wie verloren sie sich gefühlt hat, wie sie bei der Literatursuche nicht weiterkam, wie ihr Betreuer ihre erste Gliederung niedergemacht hat, wie er verlangte, dass sie viel mehr Quellen benennen sollte. Sie erzählt, wie sie danach verzweifelt suchen musste, wo sie die Informationen herhatte und wie sie oft einfach alles hinschmeißen wollte.
Noch schauen die Studierenden Frau Dr. Barlin etwas irritiert an, aber die Aufmerksamkeit hat sie.
Nun deutet sie auf den Stapel gebundener Hefte auf ihrem Tisch und erklärt den Studierenden: „Dies sind BA-Arbeiten. Und in ca. 2 ½ Jahren stehen sie vor der Aufgabe, eine solche Arbeit zu schreiben. Schon davor müssen Sie kürzere Arbeiten wie Seminararbeiten schreiben.“ Dabei deutet sie auf den kleineren Stapel von Schnellheftern neben den BA-Arbeiten. Sie fährt fort: „In diesem Seminar zum Thema ‚Wissenschaftliches Arbeiten‘ möchte ich Sie dabei unterstützen, dass Sie von Anfang an, keine solchen Erfahrungen machen müssen, wie ich, sondern schon Ihre erste Seminararbeit souverän schreiben. Dafür möchte ich Sie nun bitten, sich diese Arbeiten anzusehen und dann in Gruppen zu überlegen, was Sie in diesem Seminar lernen müssen, damit es Ihnen künftig nicht so geht, wie es mir ergangen ist.“
Dann teilt sie die BA-Arbeiten und Seminararbeiten unter den Studierenden aus.
Sogleich blättern diese interessiert darin herum und beginnen zu diskutieren.
Frau Dr. Barlin freut sich. Ihr Konzept ist aufgegangen. Der Einstieg ins Seminar ‚Wissenschaftliches Arbeiten‘ ist gelungen.
Warum? Was hat diese Dozentin richtig gemacht?
Sie hat die Studierenden mit ihrer persönlichen Geschichte überrascht. Dadurch hat sie sie irritiert und ihre Aufmerksamkeit geweckt. Nicht ausgeschlossen, dass die eine oder der andere Student ihr die Geschichte nicht abgekauft hat; dessen Aufmerksamkeit hat sie dennoch geweckt.
Dann hat sie den Studierenden aufgezeigt, was auf sie zukommen wird und hat dadurch ganz nebenbei die Relevanz der Lehrveranstaltung und deren persönlichen Nutzen für die Studierenden verdeutlicht.
Durch die beiden Schachzüge
- Storytelling und
- Relevanz/Nutzen aufzeigen
hat sie die Bereitschaft der Studierenden geschaffen, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
Ein solcher Einstieg in Lehrveranstaltungen zum ‚Wissenschaftlichen Arbeiten‘ ist vor allem dann wichtig, wenn diese Lehrveranstaltungen nicht direkt am sogenannten Point of Need durchgeführt werden, also nicht genau dann, wenn die Studierenden aktuell an einem Projekt arbeiten, das wissenschaftliches Arbeiten erfordert, also z.B. gerade an ihrer BA-Arbeit schreiben. Schreiben Studierende gerade eine solche Arbeit, benötigt man als Dozent/in keinen solchen Einstieg. Dann kann man sich der Aufmerksamkeit auch so sicher sein, weil die Studierenden sich von der Veranstaltung Unterstützung erhoffen.
In Lehrveranstaltungen, die nicht direkt am Point of Need stattfinden, eignet es sich deshalb, mit Storytelling zu beginnen und den Nutzen der Veranstaltung für die Studierenden klar herauszustellen.
Aber warum ist das so? Warum und wie wirkt Storytelling beim Lehren und Lernen? Und warum sollte man den Nutzen einer Lehrveranstaltung aufzeigen?
Die Psychologie des Einstiegs in Lehrveranstaltungen
Menschen haben in jeder Situation verschiedene Möglichkeiten zu handeln. Es gibt stets zahlreiche Dinge, denen sie ihre Aufmerksamkeit schenken können. So auch in Lehrveranstaltungen: Sie können der Lehrveranstaltung folgen, sie können sich ihren Kommiliton/inn/en zuwenden, sie können im Internet surfen, Whatsapps schreiben oder einfach ihren Gedanken nachhängen, um nur einige zu nennen.
Was aber gewinnt den „Wettkampf“ um die Aufmerksamkeit? Es ist das, was die meiste Aufmerksamkeit erzeugt. Dabei wird Aufmerksamkeit dann erzeugt, wenn ein sogenanntes mentales Ungleichgewicht (Piaget, 1976) ausgelöst wird, wenn Menschen also mit etwas konfrontiert werden, das sie irritiert, das sie nicht verstehen, das neu und andersartig ist, etwas das ihre Emotionen (Jäncke, 2014, Beck, 2015) anspricht, jedoch nicht bedroht. Da Menschen nach innerem Gleichgewicht streben, führt ein Ungleichgewicht automatisch dazu, dass Menschen beginnen, sich mit dem Ungleichgewicht und möglichen Lösungen dafür zu beschäftigen (Seel, 2017). Sie haben also einen Grund, ein Motiv dafür, etwas zu tun: Sie erwarten, so ihr Gleichgewicht wiederherzustellen. Sie erkennen also einen Nutzen darin, Engagement zu zeigen (Martin, 2017, Lewin, 1969).
Grundsätzlich sind auch Studierenden immer in Lehrveranstaltungen, weil sie darin einen grundsätzlichen Nutzen erkennen: Sie möchten mehr über das Thema erfahren (vor allem bei Wahlveranstaltungen), sie möchten eine Prüfung bestehen, sie möchten nötige ECTS sammeln, um schließlich ihr Studium absolvieren zu können.
Zumindest bis zu einem gewissen Grad sind die Studierenden, die einer Lehrveranstaltung sitzen, also motiviert und bereit, sich anzustrengen.
Wie oben gezeigt wurde, konkurrieren in der Lehrveranstaltungssituation dann aber dennoch viele verschiedene Dinge um die Aufmerksamkeit der Studierenden. Es ist deshalb die Aufgabe der Dozierenden, die Aufmerksamkeit der Studierenden zu halten und zu verstärken und ihnen den Nutzen des Themas aufzuzeigen.
Mit dem Storytelling (Adamczyk, 2015) zieht die Dozentin in unserem Beispiel zu Beginn der Lehrveranstaltung die Aufmerksamkeit der Studierenden auf sich und ihre Geschichte. Durch die Geschichte löst sie bei den Studierenden einen Ungleichgewichtszustand aus, denn diese beginnen nachzuvollziehen, dass ihnen die in der Geschichte erzählte Situation auch bevorstehen könnte. Die Dozentin verstärkt dieses Gefühl bei den Studierenden dann noch dadurch, dass sie explizit sagt, dass die Studierenden demnächst eine Seminararbeit schreiben müssen und ihnen solche Arbeiten zur Ansicht gibt. Sie zeigt ihnen damit auf, was sie nicht können und macht dadurch das Ungleichgewicht spürbar. Indem sie dann aufzeigt, dass diese Lehrveranstaltung die Studierenden dabei unterstützt, solche Arbeiten zu schreiben, indem sie ihnen also in Aussicht stellt, sie dabei zu unterstützen in ein neues Gleichgewicht zu finden, zeigt sie den Nutzen auf und gibt den Studierenden damit einen Grund, der Lehrveranstaltung zu folgen.
Denken also auch Sie daran,
- die Aufmerksamkeit der Studierenden zu Beginn der Lehrveranstaltung auf sich und vor allem auf das Thema der Veranstaltung zu lenken.
- Sprechen Sie dabei Emotionen an und lösen Sie dadurch ein Ungleichgewicht aus, so dass die Studierenden den Nutzen der Lehrveranstaltung für sich erkennen.
Viel Spaß beim Ausprobieren.
Sind Sie neugierig, wie unsere Dozentin Frau Dr. Barlin den weiteren Verlauf der Veranstaltung gestalten könnte? Dann schauen Sie doch mal in das E-Book „Ideen für gelingende Lehrveranstaltungen“ oder schauen Sie in der Facebook-Gruppe „Hochschuldidaktik“ vorbei.
Weitere Ideen für Einstiege in Lehrveranstaltungen finden Sie im kostenlosen Online-Kurs „Aktivierende Methoden für Einstiege in Lehrveranstaltungen“.
Dr. Ulrike Hanke ist Privatdozentin für Erziehungswissenschaft an der PH Freiburg und freiberufliche Dozentin für Hochschul- und Bibliotheksdidaktik. Sie hat zahlreiche Fachbücher publiziert, Online-Kurse erstellt und ist in den Sozialen Medien aktiv. Weitere Infos unter: www.hanke-teachertraining.de
Literatur
Adamczyk, G. (2015). Storytelling. Mit Geschichten überzeugen. 2. Auflage. Freiburg: Hauffe.
Beck, H. (2015). Hirnrissig. Die 20,5 größten Neuromythen – und wie unser Gehirn wirklich tickt. München: Goldmann-Verlag.
Jäncke, L. (2014). Die Neurobiologie des menschlichen Lernens. In: Bachmann, H. (Hrsg.), Kompetenzorientierte Hochschullehre. Die Notwendigkeit von Kohärenz zwischen Lernzielen, Prüfungsformen und Lehr-Lern-Methoden (2. überarbeitete und erweiterte Auflage) (S. 127-146). Bern: hep.
Lewin, K. (1969). Grundzüge der topologischen Psychologie. Bern.
Martin, A. (2017). Handlungstheorie. Grundelemente des menschlichen Handelns. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Piaget, J. (1976). Die Äquilibration der kognitiven Strukturen. Stuttgart: Klett-Verlag.
Seel, N. M. (2017). Model-based learning: a synthesis of theory and research. Educational Technology and Research and Development 65 (4), S. 931-966.