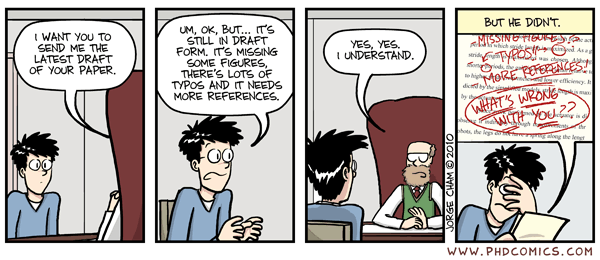Dieser Beitrag knüpft an den Beitrag „Nein, der ist nicht faul!“ an.
Folgendes Szenario: Sie lesen Hausarbeiten (wieder einmal) und kommen zur Arbeit einer Ihnen bereits bekannten Studentin. Sie sehen ein wohl recherchiertes Literaturverzeichnis (wieder einmal). Sie sehen einen roten Faden in der Gliederung und eine schlüssige Argumentation (wieder einmal).
Ein tiefes, wohliges Seufzen.
Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie?
- „Die hatte wohl richtig Lust auf das Thema.“
- „Die hat es einfach verstanden.“
- „Die hat es halt drauf.“
- „Die ist so klug.“
Übrigens, ab hier nimmt der Artikel eine andere Wendung als der Vorgänger-Artikel. Sie müssen also nicht befürchten, sich beim Weiterlesen zu langweilen.
Eine Warnung
Im ersten Beitrag haben Sie erfahren, welche verheerenden Auswirkungen negative Zuschreibungsmuster haben. Diese sollten wir als Lehrende daher nicht noch ungewollt verstärken. Stattdessen bauen wir besser gemeinsam mit den Studierenden neue positive Muster auf. So weit, so gut.
Was hat es jetzt aber mit den positiven Zuschreibungen auf sich? Die müssten ja eigentlich gut sein.
Oder?
Achtung, auch die positiven Muster sind ein wenig mit Vorsicht zu genießen.
Die ständige Wiederholung einer internen, stabilen und globalen Zuschreibung hat vielleicht gar nicht so positive Auswirkungen, wie Sie sie meinen.
Wie bitte?
Sollen Sie jetzt Ihren Studierenden nicht mehr sagen dürfen, dass Sie sie für klug, überdurchschnittlich intelligent, ganz besonders intellektuell begabt und wundervoll halten?
Was passiert, wenn Sie jemanden so etikettieren? Sie zementieren damit unter Umständen eine Vorstellung, die heißt: „Ich verfüge über ein bestimmtes, vergleichsweise hohes Ausmaß an Intelligenz. Meine Arbeit muss mir also mühelos gelingen, anderenfalls wäre ich ja vielleicht doch gar nicht so klug.“ Carol S. Dweck, die bekannte amerikanische Psychologin, nutzt dafür den Begriff fixed mindset. Sie zitiert eine ihrer Studentinnen:
„I remember often being praised for my intelligence rather than my efforts, and slowly but surely I developed an aversion to difficult challenges. […] This was my greatest learning disability – this tendency to see performance as a reflection of character and, if I could not accomplish something right away, to avoid that task or treat it with contempt.“ (Dweck 2008, S 176)
Das Gegenstück zum fixed mindset ist das viel hilfreichere growth mindset. Menschen mit dieser Ansicht glauben, dass sie sich durch Anstrengung und Übung und ja, auch durch das Genießen guter Lehre, verbessern können. Das erhöht laut Dweck nicht nur ihre Motivation, sondern auch ihre Leistung.
Sie verstehen, worauf ich hinaus möchte?
Beim Begutachten das growth mindset fördern
Beim Begutachten können wir als Lehrende viel dafür tun, dass Studierende sich weiter entwickeln wollen und auch die dafür nötige Anstrengung als etwas Positives begreifen.
Besonders gelungene Textstellen dürfen Sie natürlich der Person und nicht den Umständen zuschreiben. Sobald Sie dabei jedoch Stabilität und Allgemeingültigkeit implizieren, wird es problematisch. Wenn Sie also „Sie sind so klug“ im Sinne von „Sie sind immer so klug in allen Bereichen“ meinen, hemmen Sie unter Umständen die angesprochene Person.
Das bedeutet, dass wir bei gelungenen Textstellen lieber die damit verbundene Anstrengungen, den Aufwand und die Bemühung (effort) loben sollten.
Was merken Sie also am Rand der Arbeit an? Abwandlungen der folgenden Gedanken vom Anfang sind mehr oder weniger hilfreich:
- „Die hatte wohl richtig Lust auf das Thema.“
Sie können die Studierende gern wissen lassen, dass Sie das aus ihrem Text herauslesen. Vielleicht im Stile von „Hier spüre ich Ihre Begeisterung für das Thema!“
- „Die hat es einfach verstanden.“
Auch das ist kein Problem, wenn Sie damit meinen, dass die Studierende die an sie gestellten Anforderungen dieses Mal gut verstanden und erfüllt hat. Am Rand stünde dann wohl etwas wie „Hier zeigen Sie, dass Sie die Anforderungen verstanden haben.“
Oder meinen Sie es eher wie im folgenden Satz?
- „Die hat es halt drauf.“
Einmal gelernt, für immer gekonnt? Diese Zuschreibung geht langsam in die falsche Richtung. Was ist, wenn die Aufgaben schwieriger werden?
- „Die ist so klug.“
Mit dieser Aussage erklären Sie die Studierende für dauerhaft und übergreifend kompetent. Eigentlich eine schöne Sache, wenn nicht… Sie wissen ja. Besser als eine persönliche Zuschreibung wäre also etwas wie „Kluger Gedanke!“ oder „In diese Argumentation haben Sie sicher viel Arbeit hineingesteckt“, weil es mehr auf den Prozess des Denkens abhebt.
Das Zwischenfazit aus dem Vorgängerartikel („Interne, stabile und globale Zuschreibungen scheinen im Fall von Erfolgserlebnissen hilfreich und im Fall von Misserfolgen nicht hilfreich zu sein.“) können wir also so nicht stehenlassen.
Auch bei gelungenen Stellen im Text tun Sie Ihren Studierenden einen Gefallen, wenn Sie diese als zunächst einmal als vorübergehend und spezifisch betrachten. Sie bereiten damit den Boden für die positive Wahrnehmung von Anstrengung.
Für das Einordnen von Misserfolgen hat Dweck übrigens auch ein gutes Wort: „noch“ (yet). Anstatt „Der hat es nicht verstanden.“ denken Sie einfach „Der hat es noch nicht verstanden.“ Das lässt Raum für Entwicklung sowie Dazulernen und stützt damit das growth mindset.
Zum Weiterlesen
Dweck, Carol S. (2008): Mindset. The new psychology of success. New York: Ballantine Books.