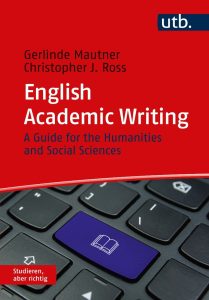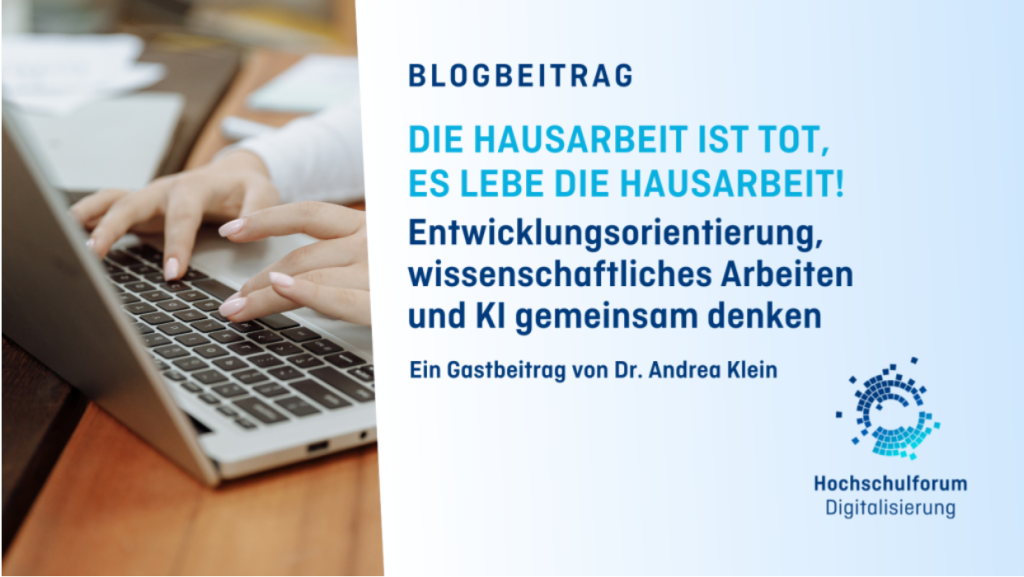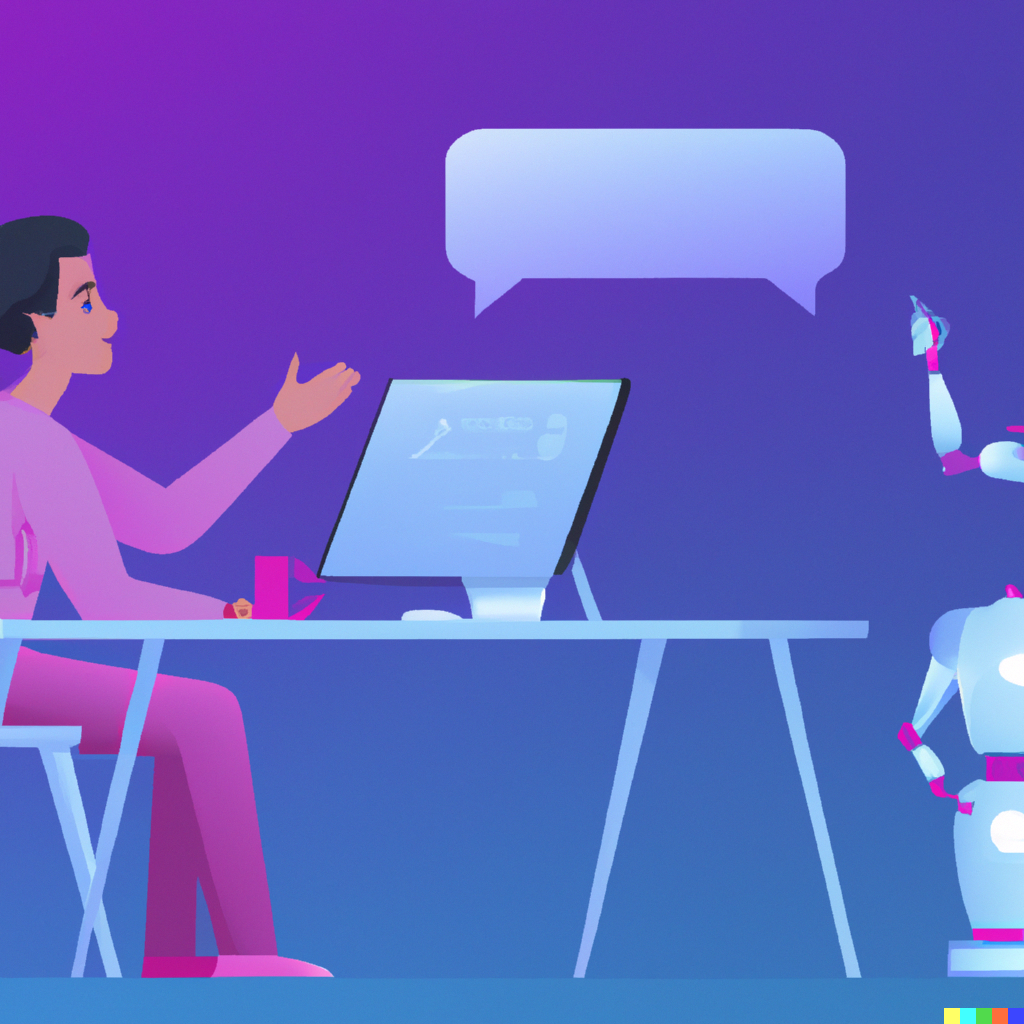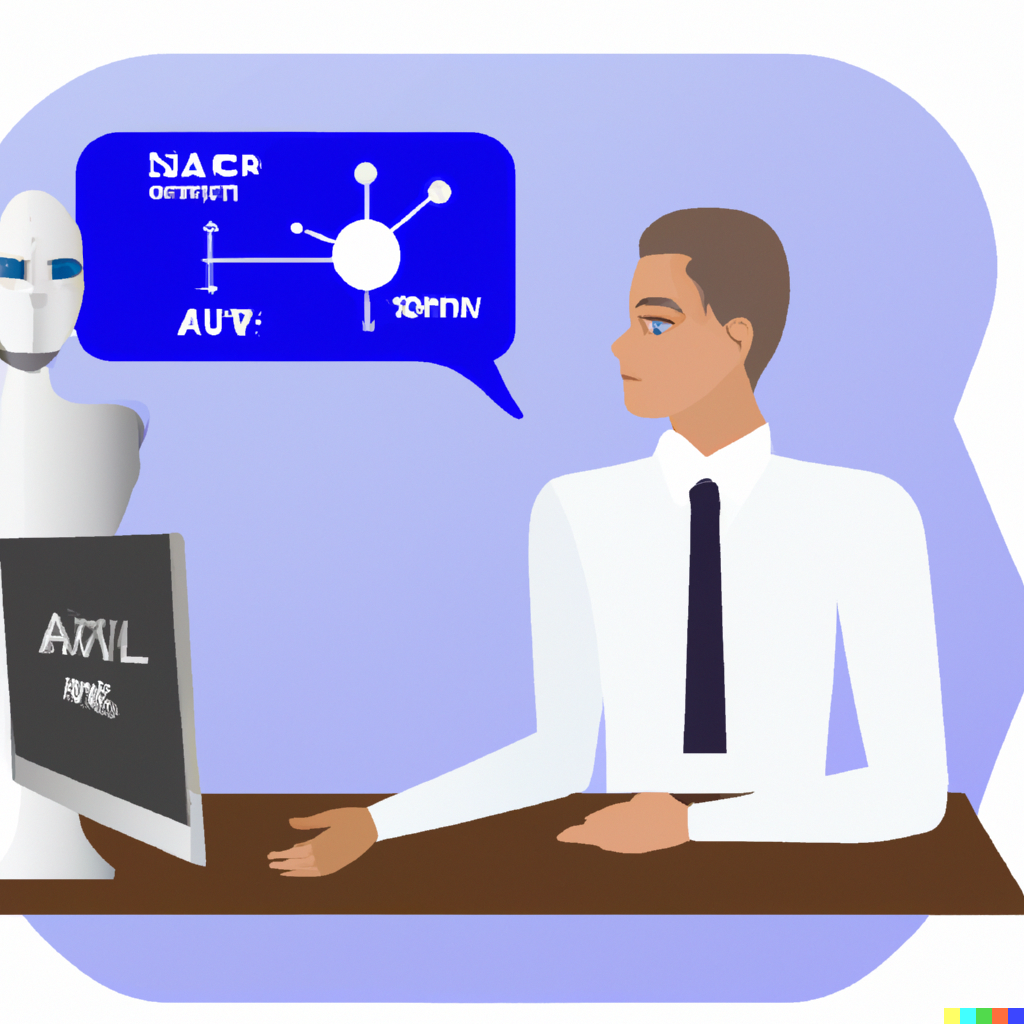Geht es Ihnen auch so, wenn Sie an KI denken?
Der Bahnsteig ist leer, der Zug ist abgefahren, alle anderen sind weg. Nur Sie stehen noch da und sind – wahrscheinlich – der einzige Mensch auf Erden, der noch nie mit KI-Tools gearbeitet hat. Na ja, oder zumindest haben Sie das nicht systematisch getan. Nur hier und da mal ein bisschen, und dann eher auch für private Zwecke. Vielleicht haben Sie auch wieder damit aufgehört, weil Sie mit den Ergebnissen nichts anfangen konnten, und Sie haben sich gefragt, ob das schon alles war. Wieso dann der ganze Hype? Oder, Moment mal, haben Sie vielleicht etwas falsch gemacht?
Sicher nutzen alle anderen die Tools schon systematisch und noch dazu sehr versiert. Haben schon herausgefunden, wie das funktioniert und wie sie sich zurechtfinden, in diesem Wust an Informationen über immer neue Möglichkeiten. Wie man richtig promptet und der KI Inhalte entlockt, mit denen sich wirklich etwas anfangen lässt.
KI-FOMO? Ja, das ist sie: die Angst, etwas zu verpassen. Nicht ausreichend Bescheid zu wissen. Was, wenn alle anderen plötzlich besser, toller, produktiver sind, weil sie eben verstanden haben, wie es geht?
Alle anderen?
Ganz sicher nicht.
Lassen Sie sich gesagt sein: Da draußen gibt es noch sehr viele Menschen, die sich nicht eingehend mit KI-Tools befasst haben. Oder genauer: Da draußen gibt es noch sehr viele Lehrende, die sich nicht eingehend – oder gar nicht – mit der Nutzung von KI-Tools für den Einsatz in Lehre und Forschung befasst haben.
Die reden nur nicht über ihre Nicht-Nutzung. Es ist en vogue, über KI Bescheid zu wissen, und diejenigen, die nicht mithalten können, reden eben nicht. Sie sitzen dabei und sind stumm. Denn über ein Jahr, nachdem die breite Verfügbarkeit von ChatGPT den Hype ausgelöst hat, erscheint es seltsam, sich noch überhaupt nicht mit diesem Thema beschäftigt zu haben.
Ist es zu spät für den Einstieg?
Ganz sicher nicht.
Das Feld ändert sich kontinuierlich und, wie viele es empfinden, beängstigend schnell. Das ist eine gute Nachricht, so paradox es klingt. Die Halbwertszeit des Wissens hier ist gering, weil die technologische Entwicklung so rasant ist. Wenn Sie jetzt einsteigen und aufholen möchten, müssen Sie also nicht alles „nachlernen“, bis Sie auf dem aktuellen Stand sind. Sie überspringen einfach das, was jetzt schon nicht mehr gilt. Damit haben sich die Früheinsteiger wochen- und monatelang befasst, jetzt ist es nicht mehr nötig. Ich finde das ein wenig vergleichbar mit anderen technischen Skills: Einer Person, die nie in der Zeit an einem PC gearbeitet hat, in der Dateinamen noch maximal acht Zeichen lang sein durften, fehlt dieses Wissen später nicht. Sie musste kein ausgeklügeltes System entwerfen, mit dem sie ihre Dateien benennen und vor allem wiederfinden kann. Genauso wenig muss eine Person, die heute in die Welt der KI einsteigt, wissen, mit welchen (viel spezifischeren) Prompts sie vor einem Jahr zum gewünschten Output gelangt wäre, wenn heute schon sehr viel durch Conversational Prompting erreicht werden kann. Ebenso ist das Wissen über bestimmte Workflows irrelevant, die noch vor kurzer Zeit üblich waren: Heute muss ich nicht mehr wissen, dass ich mir in ChatGPT einen Prompt formulieren lassen kann, um ihn in einem Bildgenerierungs-Tool zu verwenden. Denn das inzwischen multimodale ChatGPT erzeugt das Bild einfach selbst (lassen wir für dieses Beispiel außen vor, dass es natürlich Unterschiede zwischen den Tools gibt).
Die Grundlagen hingegen sind immer noch die gleichen wie vor Monaten. DIE müssen Sie kennen. Und die sind schnell erklärt. In meinen Workshops verwenden wir im ersten Angang meist nicht wesentlich mehr als eine viertel Stunde darauf. Natürlich kommen wir im Verlauf immer wieder darauf zu sprechen, aber für den Einstieg genügt es, sich kurz über die Basics zu verständigen.
Die absoluten Basics über textgenerierende KI
Bringen wir es auf den Punkt:
- Ein textgenerierende KI-Tool ist kein Lexikon.
- Ein textgenerierende KI-Tool ist keine Suchmaschine.
- Ein textgenerierende KI-Tool ist kein Mensch.
Dazu noch ein paar Worte zu Datenschutz und Sicherheit. That’s it.
Wenn diese Grundlagen klar sind, können wir in den Tool-Test starten und einfach MACHEN.
KI-Tools beim wissenschaftlichen Arbeiten
In meinen Workshops sitzen vor allem zwei Zielgruppen. Ich führe zum einen KI-Schreibwerkstätten mit Studierenden durch, zum anderen erarbeite ich mit Lehrenden, wie sie – jetzt, da KI-Tools nun einmal existieren und auch nicht mehr verschwinden werden – wissenschaftliches Arbeiten lehren können. Die Inhalte dieser Workshops lassen sich nachvollziehbarerweise nicht von den Eigeninteressen der Lehrenden lösen. Sie wollen wissen, wie sie ihre eigenen Schreibaktivitäten durch den Einsatz von KI „optimieren“.
Es ist natürlich ein berechtigtes Anliegen, das eigene Schreiben entwickeln zu wollen. Mich wundert nur die Vehemenz, mit der es manchmal vorgetragen wird. Da entsteht bei mir schnell der Eindruck, als sollen die KI-Tools jetzt richten, was schon seit Jahren im Argen liegt. Schreibprozesse, die als nicht angenehm und als zu wenig produktiv empfunden werden, sollen nun mit Hilfe der KI-Tools beschleunigt werden.
Hier kommt auch wieder KI-FOMO ins Spiel. Was, wenn alle anderen besser, toller und schneller Texte produzieren? Wenn sie mehr publizieren und dadurch ihre akademische Karriere beschleunigen? Da hätten jene das Nachsehen, die keine KI-Tools nutzen.
Auch diesen Druck verstehe ich. Dennoch halte ich die Frage nach dem optimalen KI-Tool-Workflow für zu kurz gedacht. Damit meine ich die Frage, die mir in meinen Workshops regelmäßig gestellt wird: Wie bilde ich meinen Schreibworkflow möglichst lückenlos durch KI-Tools ab?
Analyse vor Lösung, ob mit oder ohne KI
Schreibprozesse sind individuell und damit sehr unterschiedlich. Wie immer fasse ich den Begriff des Schreibens weit und verstehe darunter auch vor- und nachgelagerte Tätigkeiten wie Literaturrecherche oder Überarbeiten. (Nicht dass hier ein ungewollter Eindruck entsteht: Damit meine ich nicht, dass die Literaturrecherche zeitlich immer komplett vor und das Überarbeiten immer nach dem Schreiben liegen sollte. Vielmehr greifen die Schritte oft ineinander.)
Vor einer angestrebten Umgestaltung des eigenen Schreibens sollte vor allem die folgende Frage geklärt sein:
Wie schreibe ich überhaupt?
Das bedeutet im Einzelnen z.B.:
- Welche Raum nehmen die verschiedenen Tätigkeiten ein?
- Was gelingt mir leicht, wobei tue ich mir schwer?
- Welche Schreibstrategien setze ich, bewusst oder unbewusst, ein?
Solange das nicht geklärt ist, kann eine Lösung nicht greifen.
Bemühen wir mal zwei (zugegebenermaßen etwas schräge) Bilder:
Nummer 1: Wenn ich einen Fleck auf dem Sofa entdecke, renne ich besser auch nicht los in den Drogeriemarkt und kaufe wahllos fünf verschiedene Fleckenentferner. Erst schaue ich mir an, was den Fleck verursacht haben könnte und dann sehe ich noch nach, welche Mittelchen ich schon vorrätig habe.
Nummer 2: Wenn meine Ärztin mir sagt, ich solle gesünder leben, würde ich nicht gleichzeitig mit Intervallfasten, drei Sportarten und zehn Supplementen anfangen, sondern mich erst einmal fragen, wo genau das Problem liegt. Passt die Ernährung vielleicht schon? Ist mein Sportmix vielleicht schon ausgewogen? Dann sollte ich daran nicht drehen.
Was ich damit meine: Eine voreilige „Lösung“ verursacht oft neue Probleme (und wenn es nur bedeutet, dass ich ohne echten Gegenwert viel Geld ausgegeben habe). Diese voreilige Lösung ist eine Verschlimmbesserung.
Ok, wie geht es besser?
Schritt 1: Verschaffen Sie sich einen groben Überblick über die verschiedenartigen KI-Tools. Damit meine ich nicht, dass Sie alle Tools auf Herz und Nieren prüfen sollen. Nein, schauen Sie erst einmal, an welcher Stelle im Schreibprozess die Tools überhaupt ansetzen. Das reine Generieren von Text ist nur ein Bruchteil dessen, was möglich ist.
Schritt 2: Testen Sie gezielt, was Sie vermutlich (!) am weitesten bringt. Lesen Sie z.B. langsam, testen Sie ein Lese-Tool. Gefallen Ihnen Ihre Formulierungen oft nicht, testen Sie einmal, wie Sie den Überarbeitungsprozess mit einem KI-Tool gestalten können etc.
Schritt 3: Immer weiter im PDCA-Zyklus. „Plan – do – check – act“, das bedeutet einfach, dass Sie ausprobieren, was funktioniert, und ab da in einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess einsteigen.
Eine steile These zum Abschluss
Es wird keinen durchoptimierten Workflow mit KI-Tools für das wissenschaftliche Arbeiten geben, genauso wenig wie es einen generell gültigen Workflow für das wissenschaftliche Arbeiten gibt.
Wir werden nicht 100 Texte in Tool 1 stecken, das Ergebnis in Tool 2 weiterverarbeiten und dann in Tool 3 aufs Knöpfchen drücken und den publikationsreifen Text vor uns sehen.
Tool-Gurus: Prove me wrong!
Aber selbst wenn: Würden wir das wirklich wollen?
P.S. Ganz genau so können Sie in der Folge auch mit Ihren Studierenden an die Sache herangehen. Wenn die Studierenden Sie fragen, welche Tools sie am besten für ihre Arbeiten einsetzen sollen, fragen Sie zurück: „Wie schreiben Sie überhaupt?“