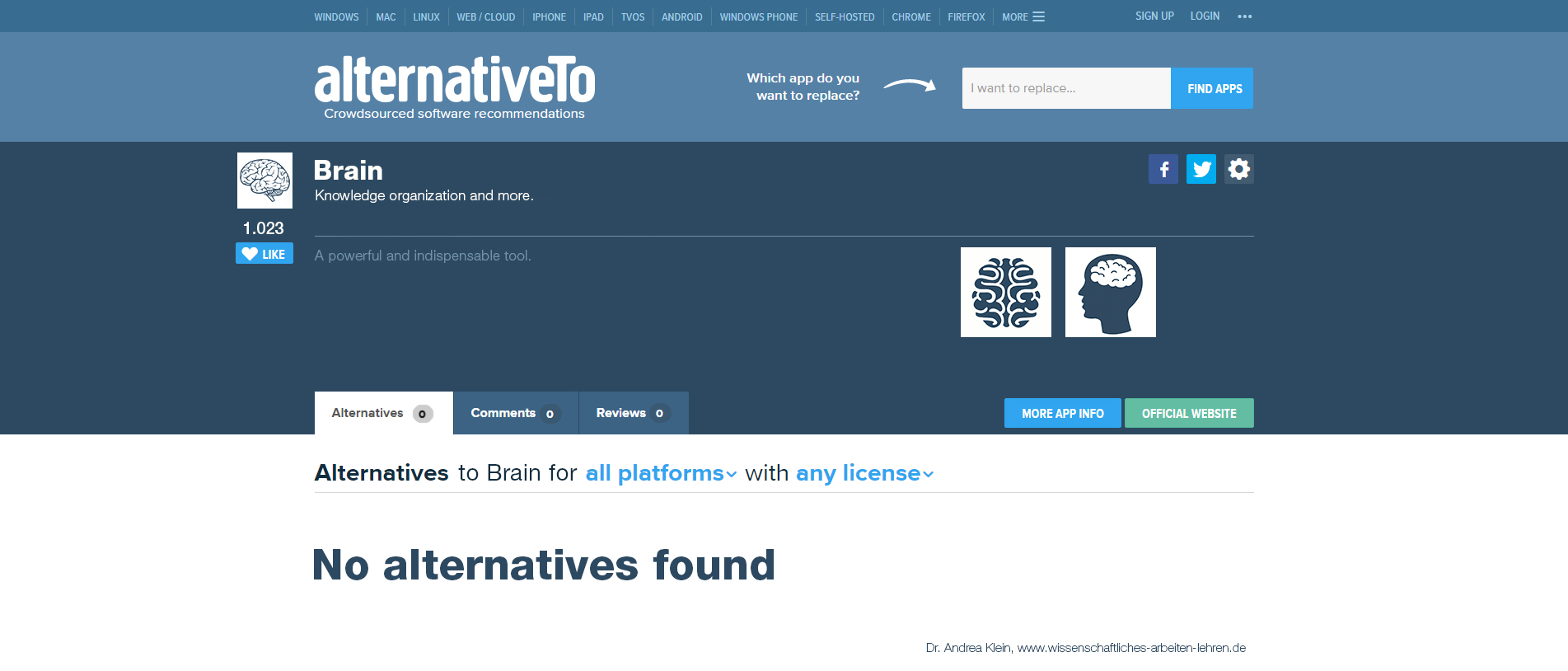Ostern ist gerade vorbei. Daher haben Sie vielleicht beim ersten Lesen der Überschrift zunächst einmal an Osternester und die Eiersuche gedacht und nicht an wissenschaftliche Literatur.
Bei der österlichen Suchaktion ist es vergleichsweise einfach: Den Dingen, die man da findet, kann man direkt ansehen, ob es sich um Geschenke handelt oder nicht. Bei der Literatursuche hingegen ist das so eine Sache: Nur weil man etwas gefunden hat, das auf den ersten Blick gut aussieht, ist es noch lange nicht inhaltlich passend oder genügt wissenschaftlichen Ansprüchen.
Bei der Suche nach Ostereiern gibt es außerdem im besten Fall eine Person, die einem mitteilt, wann man die Suche einstellen kann. Bei der Suche nach wissenschaftlicher Literatur wäre das eine feine Sache. Stellen Sie sich einmal vor, da gäbe es eine Person, die sagt „So, jetzt ist es genug, jetzt haben wir alles Wichtige zu dieser Fragestellung zusammen! Ende der Suche!“
Was Sie über die Jahre in dieser Hinsicht an Know-how und vielleicht auch an Gelassenheit aufgebaut haben, fehlt den allermeisten Studierenden natürlich noch. Grund genug, diesen Beitrag der Lehre der Literaturrecherche zu widmen.
Lassen Sie uns
- zum Einstieg auf die Grundlagen der Literaturrecherche schauen,
- dann überlegen, was die Studierenden darüber hinaus noch benötigen und
- schließlich zusammenstellen, wie Sie die Studierenden damit versorgen können.
Ein Blick zurück: Grundlagen der Literaturrecherche
Es ist eine Weile her, dass ich über Literaturrecherche geschrieben habe.
In zwei frühen Artikeln, kurz nach der Entstehung des Blogs, veröffentlichte ich im November 2015 den Beitrag „Meine persönliche Hassfrage beim wissenschaftlichen Arbeiten“ – Sie ahnen, um welche Frage es sich da handeln könnte….
Im Januar 2016 erschien der Beitrag „Achtung Literatur“ mit dem Untertitel „Warum in der Lehre der Umgang mit Literatur ein undankbares Thema ist“. Darin ist eine Art Checkliste enthalten, die jene Punkte umfasst, die es in Bezug auf Literaturrecherche und -auswahl abzudecken gilt. (Falls Sie ein gutes Wort für Scrabble brauchen . ich habe das damals spaßeshalber „Literaturrecherchenvermittlungscheckliste“ genannt.). Prinzipiell ist diese Liste immer noch gültig, auch wenn sie ein wenig in die Jahre gekommen ist. Es fehlen die vielen digitalen Helferlein und verständlicherweise auch die KI-Tools für die Recherche und Weiterverarbeitung von Literatur wie beispielsweise Research Rabbit, SciSpace und ähnliche Angebote. Diese würde ich heutzutage auf jeden Fall als Must auf der Checkliste ergänzen.
Was die Studierenden noch benötigen
Aber die Studierenden benötigen noch etwas Anderes. Außer handfesten Informationen zu Suchtechniken und Auswahlverfahren gibt es noch einen wichtigen Punkt:
Sicherheit.
Die Studierenden brauchen mehr Sicherheit und müssen dazu eine Art „Bauchgefühl“ in Sachen wissenschaftlicher Literatur aufbauen dürfen.
Wie können Sie den Studierenden zu mehr Sicherheit verhelfen?
Idee 1: Eine inhaltliche Einordnung Ihrer Literaturliste für das Seminar vornehmen
Ein erster kleiner Schritt kann es sein, im Seminar anhand Ihrer Literaturliste eine inhaltliche Einordnung vorzunehmen. Gerade in den frühen Semestern wirkt eine Literaturliste für das Seminar auf die Studierenden oftmals erschlagend. Sie wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass sie nicht alle Quellen, die darauf vermerkt sind, lesen müssen bzw. dass sie diese nicht alle mit der gleichen Gründlichkeit durcharbeiten sollten. Geben Sie den Studierenden ein paar Anhaltspunkte, indem Sie sie darauf hinweisen,
- welche Quellen gut für den Einstieg geeignet sind (Überblicksdarstellungen, ggf. Auszüge aus Lehrbüchern, Meta-Analysen)
- welche Quellenarten in Ihrer Disziplin welchen Stellenwert haben (Monographien und Sammelbände vs. Zeitschriftenartikel)
- welche Quellen in Ihrer Liste Mainstream-Positionen abdecken und welche eher „exotisch“ oder besonders kritisch oder innovativ sind
- wieso Sie ggf. auch unwissenschaftliche Quellen aufgenommen haben und
- zu guter Letzt welche Quellen Sie gut lesbar fanden und welche eine Zumutung.
So lassen Sie die Studierenden nicht nur von Ihrer Expertise profitieren, sondern bestätigen sie auch darin, dass manche Texte zugänglicher sind als andere und dass Schwierigkeiten beim Lesen nicht unbedingt immer auf die lesende Person zurückzuführen sind. Diese Einordnungen, die für Sie selbstverständlich ist, sind es für die Studierenden (noch) nicht.
Idee 2: Beispiel für Arbeiten mit wenigen und vielen Quellen
Der zweite Ansatzpunkt bezieht sich vordergründig auf die Anzahl der Quellen. Sie werden die Frage nach der Mindestzahl der zu verwendenden Quellen ja kennen. Wenn Sie ein wenig Zeit investieren möchten, suchen Sie doch einmal zwei, drei verschiedene Beispiele aus älteren studentischen Arbeiten heraus: je ein Literaturverzeichnis mit vielen und mit wenigen Quellen und vielleicht noch eines mit einer durchschnittlichen Anzahl.
Dies können Sie nun auf verschiedene Arten nutzen. Sie könnten beispielsweise den Studierenden den Titel und die Fragestellung der dazugehörigen Arbeit nennen und gemeinsam überlegen, ob die Anzahl der Quellen der Art der Arbeit prinzipiell angemessen ist. Es würde mich nicht wundern, wenn am Ende herauskäme, dass man das so gar nicht sagen kann 😉 Das hielte ich für einen wichtigen Lerneffekt.
Abschließend könnten Sie dann nachsehen, ob und welche Lücken es eventuell in den Literaturverzeichnissen gibt (je nach Ausgangslage könnte z.B. Literatur zur theoretischen Fundierung fehlen oder Methodenliteratur oder aktuelle Studien, oder, oder, oder).
Sicher, sicher!
Die beiden genannten Ideen haben gemeinsam, dass Sie als Lehrperson es den Studierenden damit ermöglichen, sicherer in ihrer Einschätzung der Literatur zu werden.
Was fehlt nun noch? Die angestrebte Sicherheit stellt sich bei den Studierenden bestimmt nicht gleich ein, nachdem Sie die beiden Ideen umgesetzt haben. Das braucht Zeit. Sie können dennoch etwas tun, um den Studierenden zu helfen.
Reden Sie mit den Studierenden über die vermeintliche Vollständigkeit der Literaturliste. Die Annahme, dass man „alles“ finden sollte, ist weit verbreitet. Haben Ihre Studierenden schon aus Ihrem Mund gehört, dass das gar nicht geht? Abgesehen von Systematic Literature Reviews, in denen die vollständige Abdeckung eines bestimmten Ausschnitts angestrebt wird, ist das Kriterium der Vollständigkeit kaum sinnvoll zu erfüllen. Ihre Studierenden brauchen also eher Hilfe dabei, die wichtigsten Positionen in einem Diskurs zu identifizieren. Erläutern Sie ihnen doch einmal, wie Menschen in Ihrer Disziplin das tun. Oder überlegen Sie, wie Sie sich selbst schnell in einer fremden Disziplin orientieren würden.
Welche Herangehensweisen nutzen Sie, um die Studierenden beim Suchen und Finden zu unterstützen? Wie geben Sie ihnen Sicherheit?