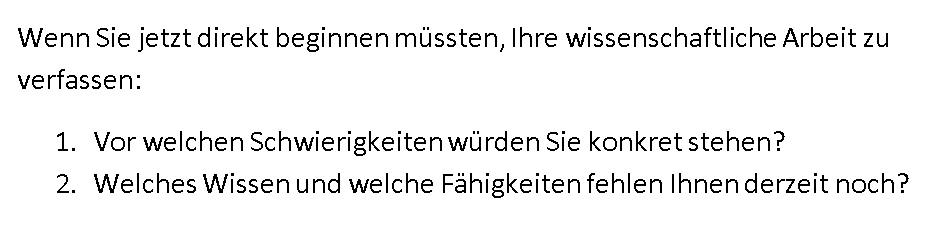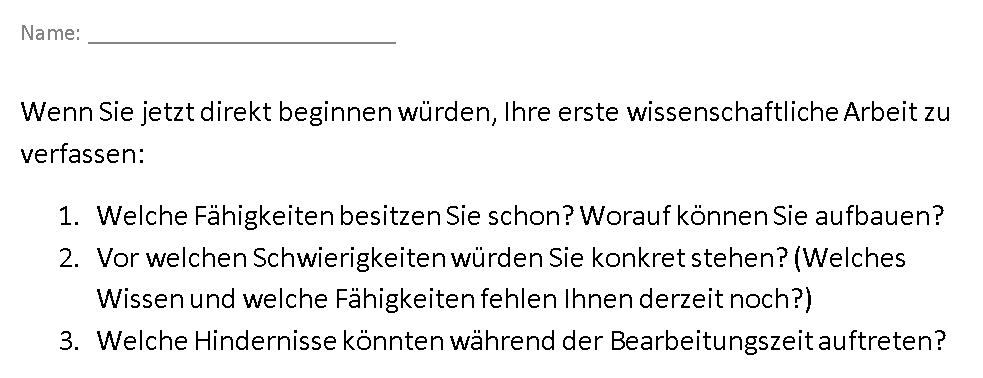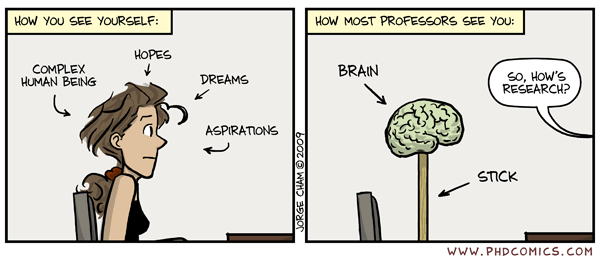Ein Gastbeitrag von Birgit Schreiber
Warum in aller Welt sollten Studierende oder Graduierte bei all der Zeitnot und dem Druck auch noch einen Ratgeber mit dem Titel „Schreiben zur Selbsthilfe“ lesen? Was soll das – bitteschön – für das Studium und die wissenschaftliche Arbeit bringen?
Andrea Klein hat mir diese Frage gestellt, als sie mich zu diesem Gastbeitrag einlud. Sie hat es – zugegeben – viel freundlicher formuliert, aber die Richtung stimmt. Das ist etliche Wochen her und zunächst wusste ich darauf überhaupt keine Antwort. Sie schien mir zu offensichtlich. Ein Studium ohne den Möglichkeitsraum, den das Schreiben bietet und zu dem ich in meinem Schreibratgeber einlade? Wie soll das gehen? Dann wurden die Antworten zahlreicher und differenzierter.
1.Schreiben schafft Möglichkeitsräume
Darunter ist diese: Studieren ist eine Herkulesaufgabe. Schnell, effektiv, flexibel und nachhaltig soll es sein (wie fast alles in der modernen Welt). An der Uni Göttingen bieten sie Zeitmanagement-Seminare für Erstsemester an. Manchmal gebe ich eines davon, es heißt nach einem Klassiker des Zeitmanagements „Wer schnell sein will, muss langsam gehen“.
In diesem Seminar lernen die Studierenden alle gängigen und empfohlenen Techniken von Pomodoro bis Eisenhower, von Tages- über Wochen- bis Jahresplanung. Die Anleitungen könnten sie sich auch selbst aus dem Internet herunterladen, dafür brauchen sie mich nicht. Was ich ihnen mitbringe, ist etwas anderes.
Es ist eine Spielwiese, ein Raum, in dem sie experimentieren dürfen und einen Schritt zurück treten aus den Alltagsroutinen. Ich nenne das in meinem Schreibratgeber den „Potential Space“, der kann je nach Bedarf ein Kraftraum, Ruheraum, Fluchtraum, Denkraum oder auch ein Weltraum sein. Hier dient er dem „bigger picture“. Damit Studierende etwa ihre Antriebskräfte finden, die sie durch ihr stressiges Studium trägt. Und damit sie auf das stoßen, was für sie wesentlich ist, ihre Werte, das, was sie ausmacht und begeistert. Sei es Karriere, Ansehen, Berufung, Forschergeist, das Bedürfnis, die Welt besser zu machen oder manchmal auch: Die Eltern glücklich.
2. Schreiben schafft Studienmotivation
Darum dürfen die Studierenden bei mir viel schreiben – beispielsweise eine Abschiedsrede für sich selbst nach 20 Jahren im Beruf – aus Sicht einer Person, die sie verehren. Manchmal machen wir es sogar noch drastischer und schreiben eine Grabrede für uns selbst. Darin kommt noch zuverlässiger zur Sprache, was die Schreibenden im Positiven ausmachte, was sie geleistet haben, was sie anderen Menschen bedeutet haben. Wie wichtig andere Menschen, wie wichtig Leistungen waren.
In Wahrheit eröffnet der Perspektivwechsel ihnen die ideale Version von ihrem Selbst und ihrem Leben. Für manche ist das eine Überraschung, manchen gibt es Kraft, manche überdenken ihre Studienwahl.
Andere müssen auch innere und äußere Kritiker besänftigen und schreiben etwa einen „unsent letter“ an eine Person der Vergangenheit, den Vater, der immer wollte, das sie eigentlich Rechtsanwältin wird oder an die ganze Familie, die womöglich fordert, das er im heimischen Dorf bleibt und den Hof übernimmt, statt an der Uni ein Doktor zu werden.
Am Schluss schreiben die Studierenden sich selbst einen detaillierten Studienplan ebenso wie ein „Mission Statement“ – nach Vorbild großer Firmen oder auch im Stile von Gene Roddenberry, der einst die Reise in „unendliche Weiten“ anstieß, um „fremde Länder zu erforschen und unbekannte Zivilisation“. „Mein Mission Statement hängt am Badezimmerspiegel. Es beflügelt mich täglich“ – bestätigte mir eine Teilnehmerin in einer persönlichen Mail einige Wochen nach dem Seminar.
3. Methoden nützen im Studium
Diese Studierende hatte auch von ihrem „Unsent Letter“ an ihre Eltern profitiert. Dies ist eine von 18 Methoden, die Kathleen Adams, Pionierin der amerikanischen „Journal“-Bewegung für die tägliche Selbstorganisation empfiehlt. Ich schreibe auch über sie in meinem Ratgeber und stelle Übungen vor, die mir besonders gefallen. Die Brief-Methode eignet sich beispielsweise wunderbar für höhere Semester und Graduierte, ja für wissenschaftliche Arbeit ganz allgemein. Ich selbst habe einen solchen Brief an einen Projekt-Antrag geschrieben und mich über seine Sperrigkeit und Komplexität beschwert. Danach kam ich einige Tage wieder in Schreibfluss, brauchte aber noch eine weitere Übung, um auch inhaltlich Klarheit über mein Thema zu gewinnen und Argumente zu ordnen. Dabei half mir der „Dialog“. Wie beim Streit mit dem Liebsten warfen das Projekt und ich uns zunächst unschöne Dinge an den Kopf, dann wurden wir zugänglicher für Argumente und schließlich entwickelten wir die Idee für Aufbau und Struktur des Antrags.
4. Schreiben schafft „scientific community“
Das Beispiel eben zeigt: Schreiben ist Denken – die Reihe der wissenschaftlichen Ratgeber ist lang, die sich auf diese Erkenntnis beziehen und die Vorteile benennen, etwa : Schreiben hilft, vom Diffusen und Abstrakten zu eigenen Worten zu kommen; es schafft kognitive Gewinne durch Formulierungsarbeit; es erlaubt epistemische und heuristische Entwicklung von Gedanken ….
Schreiben ist außerdem Kommunikation – mit dem Thema und mit uns selbst (siehe vorheriger Absatz) vor allem aber mit der „scientific community“. Es ist das Medium, in dem wir funktionieren, in dem wir uns verständlich machen (hoffentlich), in dem wir mit anderen WissenschaftlerInnen in Kontakt treten. Und unsere Erkenntnisse und Freude teilen.
Die „Lust des abduktiven Schließens “ so lautete der Titel eines Aufsatzes, für den eine Kollegin und ich während unserer Promotion gemeinsam Argumente sammelten. Wir waren wir noch ganz euphorisiert von dem Ertrag unserer gemeinsamen Denk- und Schreibarbeit in einer Forschungswerkstatt. Die Ergebnisse hatten sich endlich zum Gesamtkunstwerk geordnet, ein „abduktiver“ Schritt war vollzogen, den wir nicht hatten erzwingen können, aber für den wir mit all unseren Memos und Einträgen in die Forschungstagebücher (im free writing) die Vorarbeit geleistet hatten. Wir hatten gesät und fuhren jetzt die Ernte ein. Den Aufsatz haben wir nie veröffentlicht, aber er liegt noch immer in meiner heiligen Sammlung von wissenschaftlichen Aufsätzen und erinnert mich an die Lust, die das gemeinsame Schreiben, das gemeinsame Sammeln von Argumenten uns bereitete. Für meine Kollegin und mich wurde mit dem Aufsatz klar, dass der Prozess des gemeinsamen Schreibens und Entwickelns für uns ebenso wichtig war wie das Produkt. Es war unsere geheime Kraftquelle in der wissenschaftlichen Arbeit.
5. Schreiben fördert die eigene „Wissenschaftsstimme“
Damit das so sein kann, muss Schreiben selbstverständlich und leichtfüßig gelingen. Es darf kein Angang sein, sondern muss sich anfühlen wie ein Fluss, in den ich springe, und von dem ich mich mittragen lasse, bis ich erfrischt und gestärkt wieder heraus steigen kann. Das Gegenteil, so musste ich erfahren, ist für viele Studierende und Graduierte der Fall. Sie drohen beim Schreiben ihrer Abschlussarbeiten, in Promotionen und Habilitationen, zu ertrinken. In einer Schreibwerkstatt für Graduierte erzählten mir gestandene Frauen von ihrer Angst vor dem Schreiben, davor, nicht die richtigen Worte zu finden, ihren BetreuerInnen nicht zu genügen, nicht wissenschaftlich genug zu schreiben, sprich: keine eigene Stimme zu haben.
Die Angst ist berechtigt. Wer keine eigene Stimme hat, kann sie auch nicht mit Souveränität erheben. Die Schule des Schreibens, durch die sie in Kindheit, Jugend, an der Uni, in ihrem Fach gegangen waren, hatte ihnen gute Werkzeuge mitgeben, sie waren weit gekommen. Aber jetzt, da sie graduiert waren und in die erwachsene Welt der Wissenschaft eintreten wollten, machte ihnen der Maulkorb zu schaffen, den andere und sie selbst sich angelegt hatten. Statt eigenen Formulierungen zu trauen, schrieben manche seitenlange Paraphrasen oder zitierten andere WissenschaftlerInnen, was nebenbei bemerkt, die Gefahr des Plagiierens erhöhen kann, wenn man den Überblick dabei verliert.
An einem Workshop-Tag lassen sich diese Schwierigkeiten nicht überwinden. Eine eigene Wissenschafts-Stimme zu entwickeln braucht Zeit. Es braucht eine Spielwiese, einen Ort zum Ausprobieren, einen Ort fürs Ausruhen, zum Kraft schöpfen, zum Ideen kreieren. Am besten täglich. Wer Schreiben zu einem Begleiter in allen Lebensbereichen macht, zu einer Freundin und einem Ratgeber, ist hier eindeutig im Vorteil. Nicht nur in der Wissenschaft.
Darum, und das ist mein wichtigstes Argument für einen Schreibratgeber, lade ich auch Studierende ein, mein Buch zu lesen. Eigene Worte zu finden und sich selbst zu stärken – damit kann man in der Wissenschaft nicht früh genug anfangen.
 Dr. Birgit Schreiber ist Coach, Journalistin, Schreibtrainerin und Biographieforscherin.
Dr. Birgit Schreiber ist Coach, Journalistin, Schreibtrainerin und Biographieforscherin.
www.schreibercoaching.de
Im Frühjahr 2017 kam ihr Buch „Schreiben zur Selbsthilfe“ heraus. Hier geht es zur Rezension.