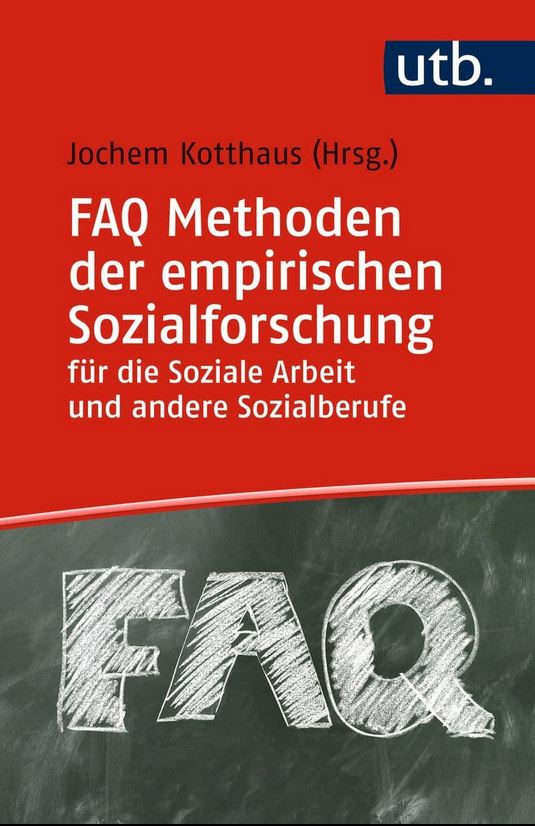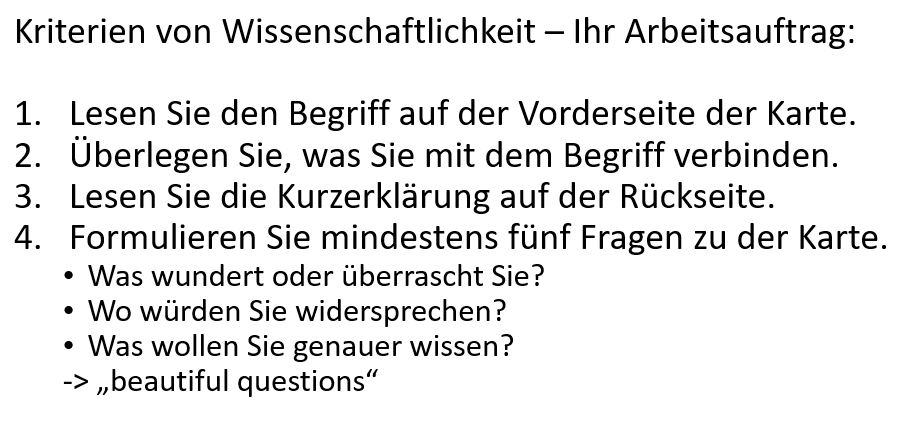Heidler, Petra; Krczal, Albin und Eva Krczal (2021): Wissenschaftlich Arbeiten für Vielbeschäftigte. Opladen & Toronto: Verlag Barbara Budrich.
19,90 Euro
180 Seiten

Inhaltsübersicht:
1 Einleitung
2 Lernergebnisse und Leitfragen
3 Themenfindung und Konkretisierung
4 Exposé
5 Bestandteile und Gliederung einer wissenschaftlichen Arbeit
6 Arten von wissenschaftlichen Arbeiten
7 Der Forschungsprozess bei empirischen Arbeiten
8 Der Forschungsprozess bei Literaturarbeiten
9 Literaturrecherche
10 Zitierweise
11 Formale Rahmenbedingungen
12 Literaturverwaltungsprogramme
Heidler, Krczal und Krzcal: Zu viel versprochen
Der Titel des Buches klingt toll: „Wissenschaftlich Arbeiten für Vielbeschäftigte“. Im Klappentext ist die Rede davon, dass man „ohne großen Aufwand“ eine gute wissenschaftliche Arbeit anfertigen könne.
Dementsprechend war meine erste Nachfrage, als das Rezensionsangebot kam, ob es denn darum ginge, wie man trotz zeitlicher Restriktionen eine qualitativ hochwertige Arbeit schreibt. Daran wäre ich interessiert; ich dachte an Vielbeschäftigte wie Studierende im dualen oder berufsbegleitenden Studium, für die ich zwar selbst ein paar Tipps auf Lager habe, aber ich lerne ja gern dazu. Einen Ratgeber für Studierende, die nach dem Prinzip „Augen zu und durch“ mit ihrer Arbeit einfach nur fertig werden wollen, hätte ich nicht rezensieren wollen.
Tja, was soll ich sagen? Bei dem Buch von Heidler, Krczal und Krczal handelt es sich keineswegs um einen „Augen zu und durch“-Leitfaden. Die Tipps für Vielbeschäftigte habe ich jedoch auch vergeblich gesucht.
Wie ist das Buch aufgebaut?
In zwölf Kapiteln sollen die Vielbeschäftigten erfahren, wie sie nun eine Arbeit erstellen, die den Anforderungen gerecht wird. Die Reihenfolge der Kapitel bzw. die Zuordnung mancher Inhalte zu den jeweiligen Kapiteln erschließt sich mir allerdings nicht.
In der Einleitung sind kurz und knapp die wesentlichen Anforderungen an eine wissenschaftliche Arbeit beschrieben. Das halte ich für eine solide Basis für alles Weitere und die Vertiefung in den entsprechenden Teilen. Kapitel 2 listet die Lernergebnisse und Leitfragen auf – und „Auflisten“ meine ich durchaus wörtlich: Viel Text gibt es in diesem Kapitel nicht. Ab Kapitel 3 (Themenfindung und Konkretisierung) dreht sich zunächst einmal alles um die grundsätzliche Anlage der Arbeit: Exposé (Kap. 4), Bestandteile und Gliederung einer wissenschaftlichen Arbeit (Kap. 5), Arten von wissenschaftlichen Arbeiten (Kap. 6, warum so spät?), bis dann Kapitel 7 und 8 den Forschungsprozess bei empirischen Arbeiten bzw. Literaturarbeiten beschreiben.
Die Techniken der Literaturrecherche und des Zitierens sind das Thema von Kapitel 9 und 10. Darauf folgen die formalen Rahmenbedingungen in Kapitel 11. Erst dann werden in Kapitel 12 verschiedene Literaturverwaltungsprogramme gegenübergestellt. Das hätte sich meiner Meinung nach viel besser beim Recherchieren und Zitieren gemacht, denn dafür sind die Programme ja nun einmal (auch) da.
Was komplett fehlt, sind Hinweise zur Zeitplanung. Hier hätte ich vermutet, dass gerade Vielbeschäftigte darüber gern mehr wissen würden.
Was mich anspricht
Die Betonung der grundsätzlichen Anlage einer Arbeit und die ausführliche Widmung des Forschungsprozesses möchte ich gern als positiv herausheben. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass diese Aspekte so detailliert behandelt werden. Gerade auch die fast gleichberechtigte Darstellung von quantitativen und qualitativen Methoden findet man nicht oft. Allerdings fehlen die Gütekriterien qualitativer Forschung, während die Gütekriterien quantitativer Forschung als allgemeingültig dargestellt werden.
Gut finde ich außerdem, dass den Literaturverwaltungsprogrammen Platz eingeräumt wurde. Auch das geschieht (noch?) selten in der einschlägigen Ratgeberliteratur. Mir fehlt allerdings eine Einordnung der vorgestellten Programme: Warum gerade diese fünf? Wie soll ich konkret auswählen? Dazu steht ein bisschen was in dem Buch, aber richtig handlungsleitend finde ich das für Studierende nicht.
Mit einem Glossar kann bei mir immer punkten. Hier ist eines vorhanden, das sicherlich beim schnellen Nachschlagen sehr hilfreich ist.
Was mir nicht gefällt
Die Liste der Aspekte, die mir nicht zusagen, ist leider sehr umfassend. Ein Hauptkritikpunkt besteht darin, dass es etliche für Studierende irreführende Punkte gibt. Die Diskussion, ob ein Ratgeber zum wissenschaftlichen Arbeiten als Beispieltext für die zu schreibenden Texte gelten können muss, ist alt. Aber selbst wenn man gegen diesen Anspruch argumentiert, so finde ich, vergibt man sich als Autor:in nichts, an bestimmten Stellen diejenige Variante zu wählen, die eben nicht irreführend ist. Auf das Buch von Heidler, Krczal und Krczal bezogen ist das – Beispiel Nr. 1 – die Literaturauswahl, auf der der Ratgeber basiert(viel Gutes und Einschlägiges, aber leider auch Veraltetes und nicht zitierwürdige Quellen). Es ist auf der formalen Seite – Beispiel Nr. 2 – die Zitation von Internetquellen, die an vielen Stellen einfach durch Angabe der URL in der Fußnote geschieht, an anderen nicht. Das ist nicht nur ungewöhnlich, sondern auch inkonsistent.
Viele weitere Kleinigkeiten könnte ich anmerken, erspare es uns aber. Nur eines noch: Die Ansprache der Leser:innen finde ich problematisch. Der Klappentext nutzt das Du, im Buch wird die Sie-Form verwendet, an manchen Stellen wird gar über „die Studierenden“ geschrieben. Das wirkt seltsam distanziert, ich werde auch aus diesem Grund mit dem Buch nicht warm. Das abrupte Ende tut sein Übriges dazu (Kapitel 12.2, „Es gibt kein ‚Richtig‘ und kein ‚Falsch‘“). Da geht es eben noch um die Entscheidung für oder gegen ein Literaturverwaltungsprogramm, als dann ein vielleicht darauf bezogener oder vielleicht auch allgemeingültiger gedachter Satz daran anschließt: „Denken Sie daran, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und jede Forscherin und jeder Forscher strebt danach, die beste Fassung seiner Arbeit zu verwirklichen“. Das hinterlässt bei mir Fragezeichen.
Welchen Studierenden kann man das Buch empfehlen?
Puh… Ich könnte auf Anhieb keine Untergruppe von Studierenden herausdeuten, für die das Buch besonders geeignet wäre. Ist es für den Einstieg gedacht oder für Fortgeschrittene? Für bestimmte Studiengänge?
Für Vielbeschäftigte, wie der Titel suggeriert, ist das Buch genauso geeignet oder ungeeignet wie viele andere Ratgeber auch. Sicher sind viele Beispiele enthalten, aber das allein hilft ja nur bedingt beim Zeitsparen. Was fehlt, um dem Titel gerecht zu werden, sind wirkliche Effizienz-Tipps: Wie finde ich bei der Literaturrecherche schnell qualitativ hochwertige Treffer? Welche Zeitersparnis bieten mir Literaturverwaltungsprogramme? Wie komme ich beim Schreiben zügig voran? Wie kann ich mich beim Überarbeiten fokussieren, so dass das nicht ausufert? (Schreiben und Überarbeiten wurden sowieso komplett ausgeklammert.)
Was bringt das Buch für den Einsatz in der Lehre?
Für Lehrveranstaltungen zum wissenschaftlichen Arbeiten ist das Buch nicht konzipiert. Manchmal hilft ja an der Stelle das Bonus-Material zum Buch. Hier wurde es angekündigt, allerdings kann ich es auf der Website nicht finden.
—
Herzlichen Dank an den Verlag für das Rezensionsexemplar!