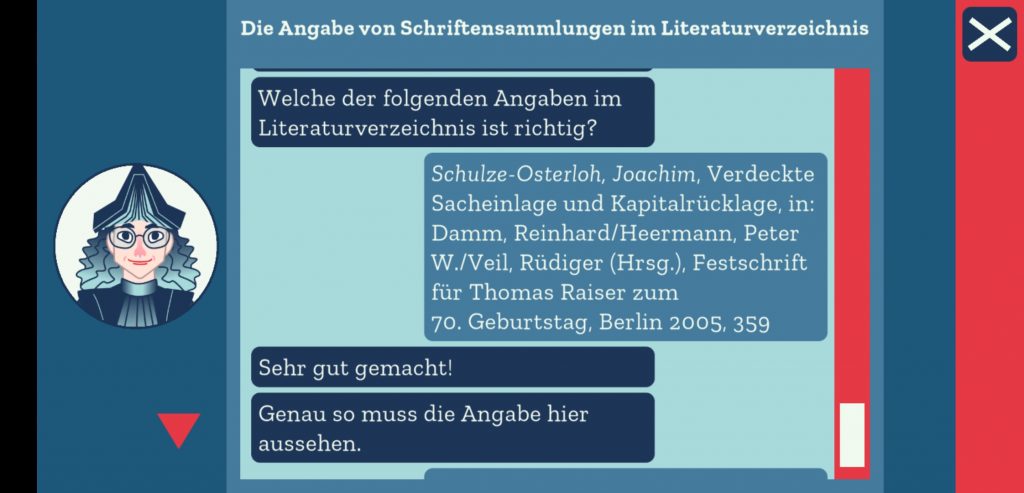Kürzlich durfte ich an einem Think Tank der Stiftung Innovation Hochschullehre teilnehmen, der unter dem Motto „Hochschullehre innovativ gestalten“ stand. Im Zuge der Vorbereitung waren alle dazu aufgerufen, eine eigene Lehrinnovation zu beschreiben, so dass diese Sammlung am Tag des Think Tanks sichtbar werden kann. Schnell fiel meine Wahl auf meine Lehrphilosophie, denn a) halte ich diese weiterhin für innovativ – dazu gleich mehr – und b) hat ihr Einsatz tatsächlich einen deutlich spürbaren Effekt auf die Lehre.
Ein kurzer Rückblick
Vor ein paar Jahren habe ich begonnen, mich intensiver mit meiner Haltung zur Lehre zu befassen und meinen Gedanken in einer Lehrphilosophie eine Form zu geben. Im Oktober 2017 habe ich das Ergebnis dann erstmals in der Lehre verwendet und auch hier auf dem Blog mitsamt einem Begleitartikel veröffentlicht.
Seitdem hat sich aus meiner Perspektive im Umfeld nichts Wesentliches getan. Weiterhin kenne ich kaum jemanden, der eine Lehrphilosophie verwendet. Auch spricht kaum jemand über ein solches Dokument oder auch nur über das Vorhaben, ein solches zu erstellen und zu nutzen.
Angeregt durch die Reaktionen während des Think Tanks schreibe ich diesen Beitrag, der eine ausführlichere Antwort auf die Fragen und Anmerkungen sein soll, als dies auf dem dort eingesetzten Miro-Board möglich war.
Wie kommt die Lehrphilosophie an?
Diese Frage ist aus mehreren Gründen nicht leicht zu beantworten.
In Präsenzseminaren teile ich die Lehrphilosophie aus und lasse sie lesen. Stille legt sich dann über den Raum, und nach dem Lesen glaube ich in vielen Gesichtern Verwunderung zu sehen. Es ist in diesem Moment auch nicht leicht, das Eis zu brechen. Meist fasst sich doch eine Person ein Herz und bekundet, dass sie gut findet, was sie da gelesen hat. Andere nicken. Oft folgt eine Anmerkung wie „So was haben wir noch nie von jemandem bekommen.“ Ab und an werde ich gefragt: „Meinen Sie das ernst?“, an guten Tagen sage ich „Ja, verdammt!“.
Inhaltliche Fragen tauchen kaum auf. Manchmal möchte jemand wissen, was es mit dem „believing game und doubting game“ auf sich hat oder was ich mit „Schreibaufgaben“ meine. Ausgiebiger wurde gern der Passus zur Nutzung von Laptops und Smartphones diskutiert, was mittlerweile etwas aus der Zeit gefallen scheint.
Was mich zum nächsten Punkt bringt: Im digitalen Raum spüre ich weniger Resonanz auf die Lehrphilosophie. Zum einen ist sie nur eine weitere Datei unter vielen, ich kann sie nicht physisch austeilen. Zum anderen sehe ich meist die Gesichter während des Lesens und unmittelbar nach dem Lesen nicht. Hier geht etwas verloren, weil ich nicht mehr in der Gruppe stehe und gleichzeitig für etwas stehe. Die sonst aufkommende Atmosphäre lässt sich im Digitalen schwer hervorrufen. Auch wenn ich wirklich gern online lehre, fehlt mir dieser Moment zu Beginn eines Seminars.
Was ändert die Lehrphilosophie für mich?
Kurz gesagt: Alles.
Ich kann natürlich nur mein eigenes Vorher und Nachher in der Lehre vergleichen. Meine Lehre ohne Lehrphilosophie war sicher von der gleichen Haltung getragen und von den gleichen Gedanken geprägt. Inhaltlich hat sich also nichts geändert, dafür aber strukturell. Die Haltung und die Gedanken sind nun formuliert und schriftlich festgehalten und somit erst einmal unverrückbar. Ich mache den Studierenden die Lehrphilosophie zugänglich und lege mich damit auf genau diese Haltung und Gedanken fest.
Der Offenheits-Vorschuss
Diese Festlegung nehmen die Studierenden natürlich wahr. Sie haben da nun eine Dozierende vor sich, die einen Standpunkt einnimmt und diesen offen kommuniziert.
Ich gebe durch dieses Vorgehen einen Offenheits-Vorschuss – und erhalte Offenheit zurück. Mein Eindruck ist: Wir kommunizieren auf eine andere Art und Weise, eben offener. Das macht sich bemerkbar in einer Öffnung der Studierenden über die eigenen Unsicherheiten und Zweifel in Bezug auf das Lernen. Als Lehrende bekomme ich mehr mit, kann es aufgreifen und damit arbeiten, so dass am Ende ein besseres und angenehmeres gemeinsames Lernen entsteht.
Festnageln?
Eine solche Transparenz macht Versprechungen. Ich teile meine Haltung und meinen Anspruch an mich selbst den Studierenden mit, woraus die Studierenden zurecht Ansprüche ableiten: „Was sie da verspricht, soll sie einhalten!“
Ich empfinde das nicht als Einengung oder als Festnageln. In der Lehrphilosophie ist gewissermaßen der Kern meiner Ansichten niedergeschrieben. Dieser Kern ist nicht tagesformabhängig, er gilt bis auf Weiteres immer. An den Rändern bin ich beweglich.
Das bedeutet: Mein Menschenbild, meine Werte und mein Verständnis von Wissen unterliegen keinen Schwankungen, die durch den Alltag oder eine bestimmte Lehr-Lern-Situation hervorgerufen werden. Die Aussagen zu den Lehrmethoden, zum Setting und den Lehrzielen sind so grundlegend und gleichzeitig offen, dass sie mich leiten, aber nicht einengen.
Langzeitwirkungen
Ein Großteil der Wirkung entzieht sich wahrscheinlich meiner Kenntnis, weil wir uns im Lauf der Seminare nicht übermäßig über die Lehrphilosophie austauschen. Das eine oder andere Mal habe ich am Ende gefragt, was die Studierenden im Rückblick von der Lehrphilosophie halten. Die Antworten fielen bisher immer positiv aus, was natürlich der Situation geschuldet sein mag – nicht viele haben Lust, am Ende eines Seminars eine Diskussion vom Zaun zu brechen. Vielleicht gehe ich dazu über, mir zu diesem Punkt anonymes Feedback einzuholen.
Einen Teil ihrer Wirkung entfaltet die Lehrphilosophie wohl auch erst geraume Zeit später. Ehemalige Studierende melden sich nach Jahren mit einem aktuellen Anliegen bei mir, getragen von dem gleichen Vertrauen, das sie damals schon hatten. Sie schildern mir, wie sie sich damals gesehen fühlten, und sprechen mit der gleichen Offenheit wie zu Studienzeiten mit mir. All das mag anderen Lehrenden auch ohne Lehrphilosophie geschehen, ich weiß es nicht. Meine Vermutung ist allerdings, dass sich die Wahrscheinlichkeit dafür mit einer Lehrphilosophie erhöht, eben weil diese nach meiner Erfahrung zu einem besseren Miteinander führt.
Wieso die Lehrphilosophie kein Lernkontrakt sein soll
In meinem Verständnis ist ein Lernvertrag oder Lehrkontrakt sehr viel konkreter auf eine einzelne Veranstaltung bezogen und nimmt deren Ziele in den Fokus. Gedanklich nachgelagert werden bestimmte Verhaltensweisen vereinbart („pünktlich sein“, „Handy aus“).
Das Wesen der Lehrphilosophie ist ein anderes: Ich lege meinen Standpunkt dar, von dem aus ich die Welt sehe und von dem aus ich mit anderen Menschen, in dem Fall mit den Studierende, umgehe. Dieser Standpunkt ändert sich nicht so schnell. Das bedeutet gleichzeitig, dass er natürlich nicht auf immer und ewig gleichbleiben muss. Aber eine zweite Version der Lehrphilosophie würde eine intensive Auseinandersetzung mit den potenziell zu ändernden Inhalten erfordern. Dies wiederum setzt eine Unzufriedenheit oder zumindest einen Anlass voraus. Das ist derzeit für mich nicht der Fall, ich bin weiterhin glücklich und zufrieden mit dem, was ich damals geschrieben habe.
Mit einer Einschränkung: Der bereits angesprochene Passus zur Laptop- und Smartphone-Nutzung ist zumindest diskussionswürdig bzw. wäre es in dem Moment, in dem wir wieder Präsenzseminare halten. Das ist noch einmal ein eigener Artikel, dessen Entwurf seit Monaten in der Schublade liegt.
Think again
Der Think Tank hat seinen Zweck erfüllt. Ich konnte sowohl etwas beitragen als auch etwas mitnehmen. Der Think Tank hat, so vermute ich, bei allen Beteiligten weiterführende Denkprozesse angeregt und ihnen eine Richtung gegeben.