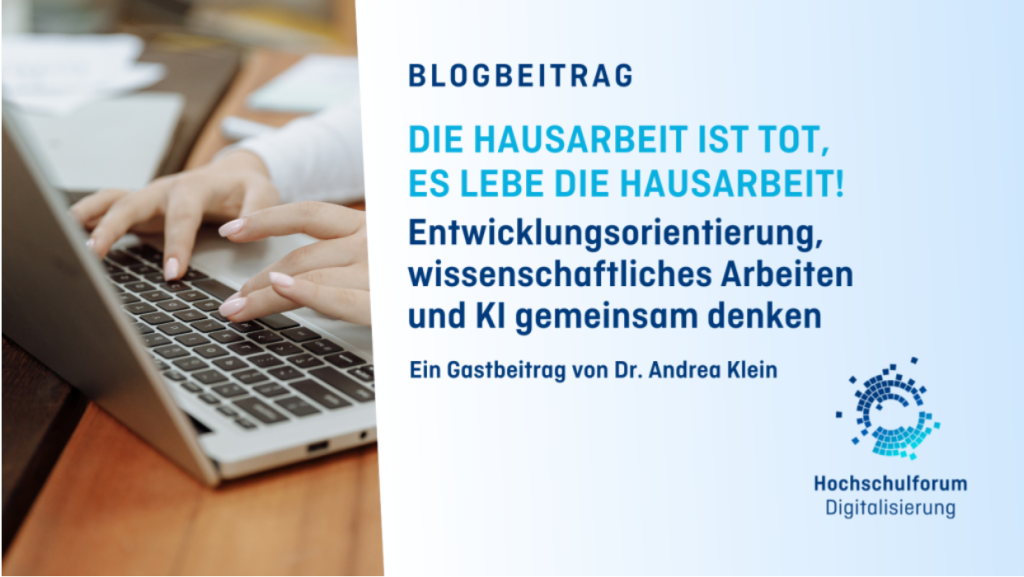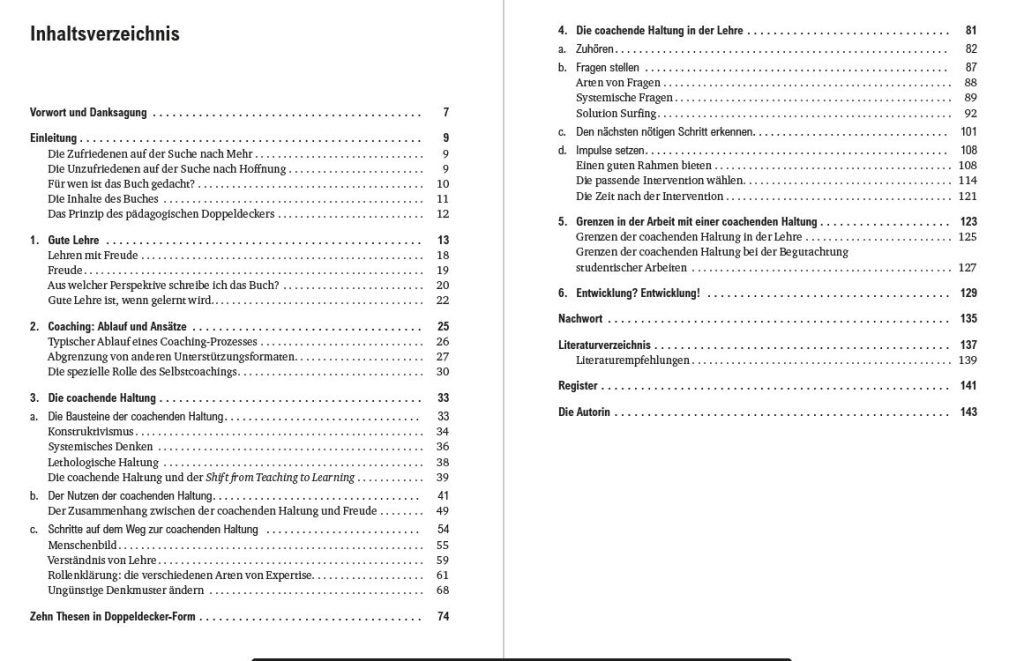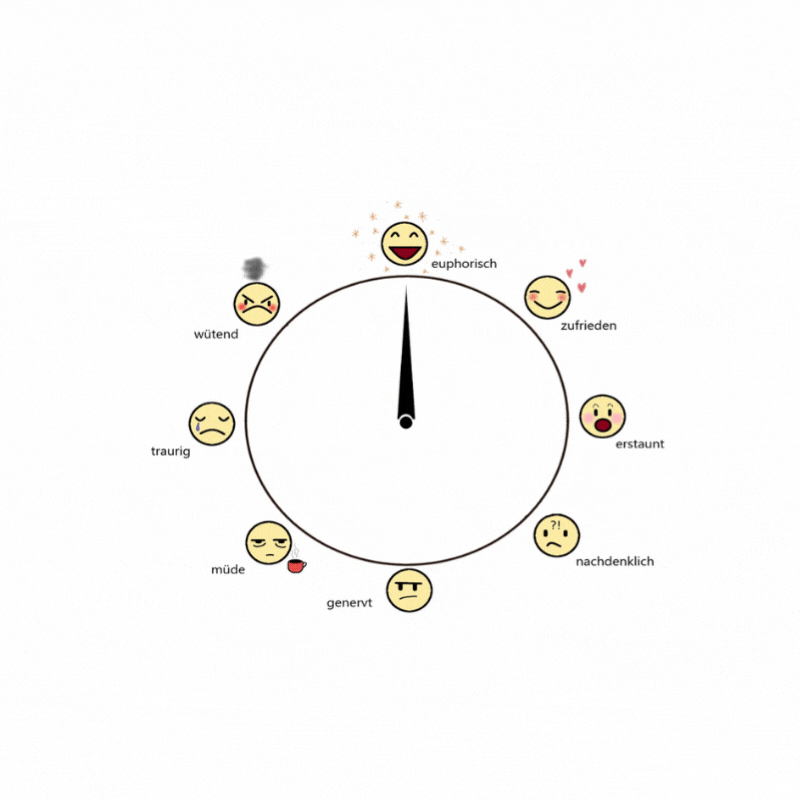Teil 1
Ein Gastbeitrag von Katharina Pietsch, Tyll Zybura und Jessica Koch (Unconditional Teaching)
Unconditional Teaching (bedingungslose Lehre) basiert auf der Grundüberzeugung, dass Lernen dann gelingt, wenn Lernende ihr Lernen für sich selbst bedeutungsvoll machen können und es in gleichwürdige, wertschätzende Lehr-Lern-Beziehungen eingebettet sehen. Was das für das Lehren von wissenschaftlichem Arbeiten bedeutet, haben wir hier in zehn Prinzipien zusammengefasst:
1) Gute Lehr-Lern-Beziehungen sind die wichtigste Basis.
Alles Lernen findet in Beziehungen statt, aber die Art und Qualität dieser Beziehungen hat großen Einfluss auf die Qualität und den Erfolg von Lernen. Wissenschaftliches Arbeiten zu lehren bedeutet, Studierende in die Diskursgemeinschaft unserer wissenschaftlichen Disziplin einzuladen. Je mehr Studierende sich in dieser Einladung als Personen gesehen, wertgeschätzt und ermutigt fühlen, umso eher sind sie bereit, die Einladung auch anzunehmen und in selbstbestimmter und selbstverantwortlicher Weise nach ihrem Platz in unserer Wissenschaft zu suchen.
Deshalb sind bedürfnisorientierte, empathische, vertrauensvolle und gleichwürdige Lehr-Lern-Beziehungen so wichtig – also Beziehungen, in denen das gemeinsame Menschsein wichtiger ist als Didaktik, Lernziele und Bewertung. Etabliert und gepflegt werden diese Beziehungen durch wertschätzende Kommunikation.
Kommunikation, die es erlaubt, sich in Bildungskontexten als Mensch zu zeigen, schafft nicht nur wohltuende Beziehungen zwischen Lehrenden und Lernenden, sondern auch zwischen den Lernenden und dem wissenschaftlichen Gegenstand: Wenn Studierende durch die Beziehung zu uns sehen können, was unsere Expertise uns bedeutet, dass wir Integrität und Würde als forschende Menschen haben, dann können sie viel leichter in eine positive Beziehung zu unserer Wissenschaft treten.
Mehr dazu lesen und hören:
Peter Felten & Leo Lambert: Relationship-Rich Education: How Human Connections Drive Success in College. Johns Hopkins UP, 2020.
Tyll Zybura: „Empathisch handeln (statt empathisch sein)“ https://www.unconditional-teaching.com/index.php?pg=empathisch-handeln
Jessica Koch: „Radical Acceptance and expectations in teaching“ https://www.unconditional-teaching.com/index.php?pg=radical-acceptance
The Unconditional Teaching Podcast: „Radikale Akzeptanz“ (https://www.unconditional-teaching.com/index.php?pg=podcast-radikale-akzeptanz)
2) Lernen gehört den Lernenden.
Lehre ist kein linearer, mechanischer Akt der Wissensvermittlung: aus meinem Mund in deinen Kopf. Als Lehrende*r kann ich nur Angebote machen, und ich muss akzeptieren, dass ich keine Kontrolle darüber habe, ob und wie meine Angebote angenommen werden. Das Lernen ‚gehört‘ mir nicht, es gehört den Lernenden. Wenn wir das zu einem Grundprinzip unserer Lehre machen, wird es für Studierende viel leichter, Verantwortung für ihr eigenes Lernen zu übernehmen und uns als Ressource und Unterstützung wahrzunehmen. Und wenn wir es ernst meinen damit, Lernende nicht als formbare Objekte, sondern als Akteur*innen ihrer eigenen Lernprozesse zu behandeln, dann macht es auch Sinn, sie aktiv nach ihren Lernbedürfnissen zu fragen.
Als Lehrende haben wir trotzdem die Prozessverantwortung für den Lernkontext und damit die Verantwortung für die Angebote, die wir Studierenden machen. Damit meine Angebote angenommen werden können, müssen sie als sinnhaft empfunden werden: Lernen passiert nur, wenn es für die Lernenden bedeutungsvoll ist.
Das kann bedeuten, dass wir den mündlichen oder schriftlichen Beiträgen von Studierenden in unserem Unterricht aktiv einen Wert geben, statt sie lediglich auf Korrektheit zu überprüfen. Oder dass wir Aufgaben so gestalten, dass sie die Basis für die nächste Unterrichtseinheit bilden. Oder dass wir in unseren Kursen Projekte oder Wissenschaftsformate umsetzen, innerhalb derer die einzelnen Unterrichtseinheiten als Schritte hin zu einem Ziel ganz von selbst Sinn ergeben. Oder dass wir den Arbeiten der Studierenden eine reale kommunikative Funktion geben, statt sie als reine Bewertungsobjekte zu behandeln.
3) Wissenschaftliche Forschung basiert auf Neugier und Kreativität, und Bewertung und Benotung sind für beide schädlich.
Neugier und Kreativität sind Grundbedingungen erfolgreichen wissenschaftlichen Forschens und erfolgreichen Lernens. Beides bedeutet, Neues auszuprobieren, oft mit einer beträchtlichen Wahrscheinlichkeit, dabei zu scheitern. Je mehr wir bereit sind, das Risiko des Scheiterns einzugehen, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir herausfinden, was tatsächlich funktioniert. Mit anderen Worten: Je mehr Neugier und Kreativität in Lern- und in Forschungsprozesse einfließen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir erfolgreich sind und dass wir dabei eine bereichernde Erfahrung machen.
Deshalb haben Lernen und Forschen viel mit Neugier und Kreativität und dem Eingehen von Risiken zu tun – und für all diese Dinge ist es schädlich, wenn andere Menschen sich in bewertender und beurteilender Weise einmischen. Sobald wir uns Sorgen darüber machen, wie andere uns beurteilen, verlagert sich unser Fokus auf das, was im Kopf dieser anderen Person vorgeht, und die Neugier auf das, was wir zu lernen und herauszufinden versuchen, rückt in den Hintergrund. Hinzu kommt: Je mehr Macht diese Beurteiler*innen haben und je mehr von ihrem Urteil abhängt, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr Urteil Gefühle von Angst und Scham hervorruft. Und sowohl Angst als auch Scham sind schädlich für Neugierde und Kreativität und damit für Lernen und Forschen insgesamt.
Wir können als Lehrende für unsere Studierenden ein Diskursumfeld schaffen, das ihnen zeigt, dass wir – als Kolleg*innen im Forschungsfeld – gemeinsam mit ihnen am Inhalt ihrer Arbeit interessiert sind. Indem wir uns nicht als ultimative Bewertungsinstanz zeigen, sondern als ernsthaft interessiert an ihrem wissenschaftlichen Beitrag, können unsere Studierenden uns als Verbündete wahrnehmen, was Scham- und Angstgefühle verringert. Wir arbeiten an einem gemeinsamen Ziel, das durch die Studierenden und ihr eigenes akademisches Interesse definiert wird.
Statt uns in erster Linie als Bewerter*innen und Benoter*innen zu verstehen, sollten wir so weit wie möglich:
- sichere Räume für die Kreativität und Riskantheit von selbstverantwortlichem Lernen schaffen
- Studierende als Forschende sehen und behandeln
- kollegiales Feedback geben, statt zu bewerten und zu benoten
- revisionsorientierte Schreibbetreuung anbieten, das heißt, Studierenden ermöglichen, einen fortgeschrittenen Text nach Feedback zu überarbeiten (und ihnen damit das gleiche Privileg zugestehen, das jede*r professionelle*r Wissenschaftler*in für sich in Anspruch nehmen kann, nämlich einen Text erst nach einem Rückmeldungsprozess zu finalisieren; das hilft auch dabei, die Ausgeliefertheit gegenüber Bewertung und Benotung abzumildern)
Mehr dazu lesen:
Katharina Pietsch: „Learning With the Freedom to Make Mistakes“ (https://www.unconditional-teaching.com/index.php?pg=learning-with-the-freedom-to-make-mistakes)
Tyll Zybura: „Revision-oriented Supervision of Student Writing“ (https://www.unconditional-teaching.com/index.php?pg=revision-oriented-writing-supervision)
4) Wenn wir wollen, dass Studierende sich wie Wissenschaftler*innen verhalten, müssen wir sie auch wie Wissenschaftler*innen behandeln.
Studierende machen im Studium nur selten die Erfahrung, dass ihre Ideen und die Ergebnisse ihrer Arbeit als Beiträge zur Diskursgemeinschaft ihrer Disziplin wahrgenommen und gewürdigt werden. Obwohl Kommunikation innerhalb der Diskursgemeinschaft zentraler Teil wissenschaftlichen Arbeitens ist, sind Studierende davon ausgeschlossen. Ihre Arbeit wird von anderen üblicherweise nur als Bewertungsobjekt wahrgenommen und behandelt, und das hat Auswirkung auf Sinn, Bedeutung und Motivation bei dem, was Studierende an der Uni tun. Dass etwa studentische Texte, die in wochen- und monatelanger harter Arbeit entstehen, ohne inhaltliche Resonanz mit einer Note versehen oder mit ein paar Credit Points vergütet werden und dann für immer in der Schublade verschwinden, ist eine systematische Abwertung der wissenschaftlichen Leistung, die in diesen Texten steckt.
Unser universitäres Ausbildungssystem leistet sich also die Diskrepanz, von Studierenden zu erwarten, dass sie sich verhalten wie Forschende, aber behandeln lassen wie Schüler*innen – das ist ein Widerspruch, der viele Schwierigkeiten beim Lehren von wissenschaftlichem Arbeiten erklärt. (Und ein Widerspruch, den vor allem Studierende ausbaden müssen, was bis hin zu Beeinträchtigungen ihrer mentalen Gesundheit führen kann.)
Wenn wir wollen, dass Studierende ihre eigene Arbeit als inhaltlich bedeutsam wahrnehmen und sich intrinsisch motiviert für eigene Forschungsthemen interessieren, müssen wir als Lehrende die Bedingungen dafür schaffen. Vermeintlich desinteressierte oder demotivierte Studierende sind meistens das Ergebnis der jahrzehntelangen Erfahrung, immer nur von anderen vorgegeben zu bekommen, was lernenswert ist, und nie nach den eigenen Interessen gefragt zu werden. Eins der wichtigsten Dinge, die Studierende deshalb von uns brauchen, ist die explizite Erlaubnis, ihre eigenen Ideen zu verfolgen.
Um Studierenden zu zeigen, dass wir sie als Forschende wahrnehmen, können wir sie außerdem einladen, an Konferenzen teilzunehmen oder diese selbst zu organisieren, oder sie dazu ermutigen, ihre Arbeit zu publizieren.
Und wenn Studierende eigene Ideen und Forschungsinteressen verfolgen, rückt in der Lehre automatisch die Frage stärker in den Vordergrund, was Studierende dafür brauchen. Die Frage, „was brauchst du?“ wiederum gibt den Lernenden die Verantwortung für ihr eigenes Lernen zurück.
Mehr dazu lesen:
Stefan Kühl: „Der publikationsorientierte Erwerb von Schreibkompetenzen.“ Das Hochschulwesen, 5+6/2015, S. 143–157.
Dzifa Vode & Frank Sowa (Hg.): Schreiben publikationsorientiert lehren: Hochschulische Schreiblehrkonzepte aus der Praxis. wbv, 2022.
5) Bedeutungsvolle Kontexte gestalten.
Das, was Studierende können, hat viel mit dem Kontext zu tun, der ihrem Arbeiten mehr oder weniger Sinn und Bedeutung gibt. Es lohnt sich für Lehrende, Lernkontexte zu schaffen, die zum Vorschein bringen, was Studierende tatsächlich können – das sorgt nicht nur für sinnhafte, selbstwirksame und motivierende Erfahrungen mit wissenschaftlichem Arbeiten für Studierende, sondern beschert auch uns als Lehrenden mehr Erfolgserlebnisse als das defizitorientierte Abprüfen von Wissen und Kompetenzen. Und die Qualität der Arbeiten von Studierenden steigt, weil Studierende, die eigene Forschungsergebnisse präsentieren möchten, ein größeres Bewusstsein für die kommunikative Funktion der Konventionen ihrer Diskursgemeinschaft bekommen.
Statt studentische Arbeiten als Hausaufgaben, Fingerübungen oder Probestücke zu sehen, sollten wir ihnen so weit wie möglich Bedeutung als Teil von Wissenschaftspraxis geben. Kontexte, in denen die Arbeit von Studierenden einen Platz als Forschungsbeitrag bekommt und inhaltliche Resonanz erfährt, können zum Beispiel Kurskonferenzen (professionelle Präsentation eigener Forschung vor Lehrenden und Studierenden des Fachs) oder Writers’ Rooms (publikationsorientierte Texterstellung mit Peer-Feedback) sein.
Mehr dazu lesen und hören:
Katharina Pietsch: „Lehrkonzept Kurskonferenz“ (https://www.unconditional-teaching.com/index.php?pg=student-conference-reflection)
The Unconditional Teaching Podcast: „Teaching a Writers’ Room“ (https://www.unconditional-teaching.com/index.php?pg=teaching-a-writers-room)
In Teil 2 dieses Gastbeitrags geht es weiter mit:
6. Lernen als Aneignung von Strategien statt von Kompetenzen denken.
7. Die eigene Wissenschaftspraxis transparent machen.
8. Funktionen lehren statt Regeln.
9. Wissenschaft bedeutet, Positionen zu verteidigen, nicht Fakten zu finden.
10. Plagiate als handwerkliches und nicht als moralisches Problem behandeln.
Über uns:
Wir – Katharina Pietsch, Tyll Zybura und Jessica Koch – sind oder waren Lehrende und Forschende an der Universität Bielefeld in der anglistischen Literatur- und Kulturwissenschaft. Gemeinsam haben wir 2019 das Projekt Unconditional Teaching gegründet mit dem Ziel, Konzepte für beziehungsreiche und machtsensible Lehre zu entwickeln. Auf unserer Webseite veröffentlichen wir Texte und den Unconditional Teaching Podcast zu Haltungen und Praktiken, die dabei helfen können, Lehre bedürfnisorientierter, wertschätzender und menschlicher zu machen. Und wir schulen Hochschullehrende in empathischer Kommunikation, in Sensibilität für mentale Gesundheit und in innovativen Ansätzen kollaborativer Lehre.
Tyll und Katharina haben außerdem zusammen mit Vivian Gramley den Ratgeber Writing in English Studies: A Guide for Students in English Linguistics and Literature (Barbara Budrich 2020) veröffentlicht, der unseren nicht-normativen Ansatz für das Lehren von wissenschaftlichem Schreiben widerspiegelt und den Fokus darauf legt, die Funktionen disziplinspezifischer Konventionen transparent zu machen und Studierende zu ermutigen, Expert*innen ihres eigenen Schreibens zu werden.
Webseite: www.unconditional-teaching.com
E-Mail: team@unconditional-teaching.com
Instagram: @unconditionalteaching
Tyll auf Linkedin: https://www.linkedin.com/in/tyll-zybura/
Katharina auf Linkedin: https://www.linkedin.com/in/katharina-pietsch-4bb626237/